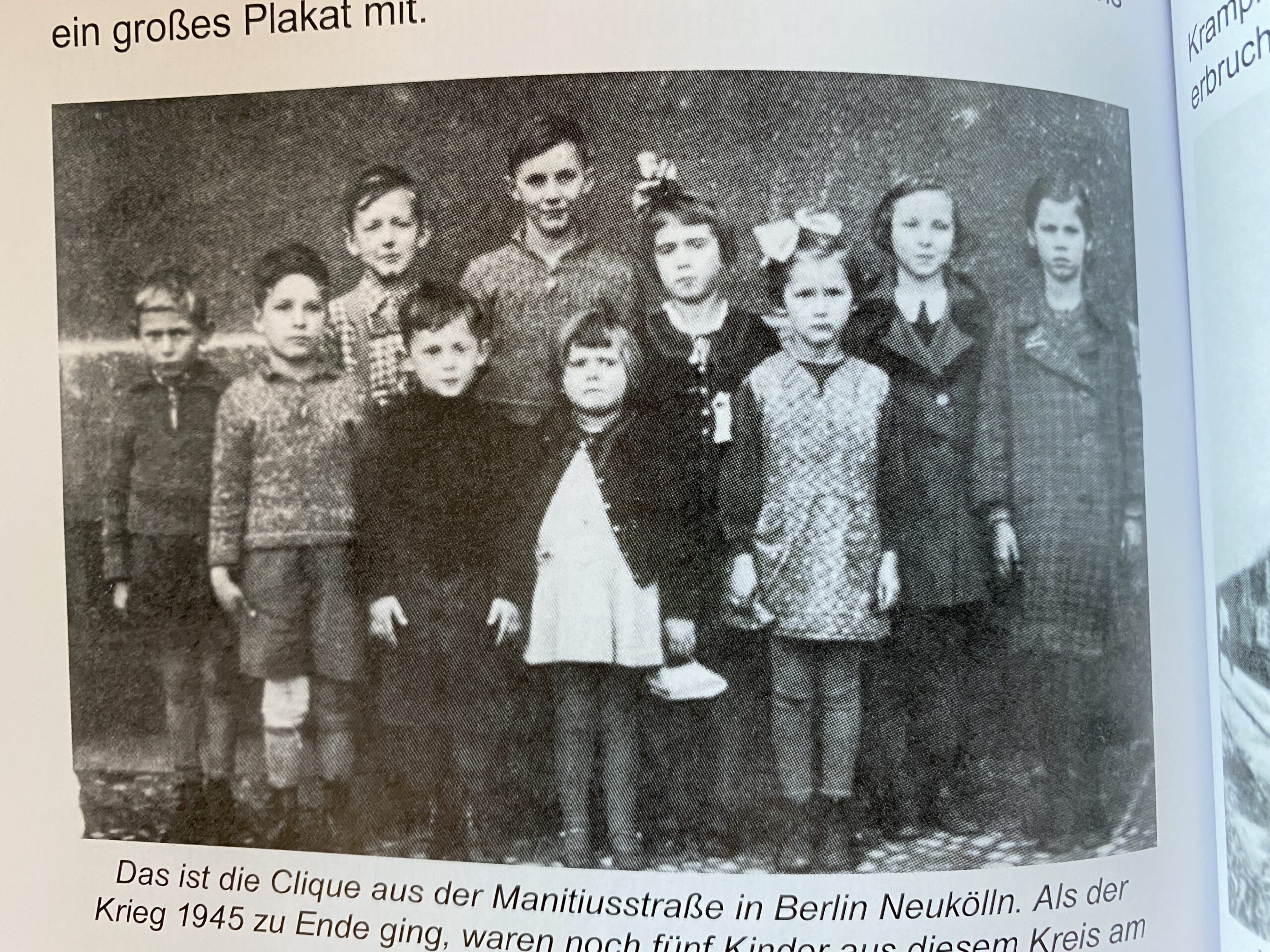Auf Maos Spuren
Moin. Früh, mittags, abends schallt einem dieses kurze Moin entgegen. Oben im hohen Norden. Mal zackig, mal vernuschelt, aber stets, wenn man sich irgendwo begegnet, zwischen Föhr und Wangerooge. Wer wie wir mit dem Rad ohne Elektro-Energie übers Land strampelt, vorbei an Maisfeldern, Kuhweiden und obligatorischen Windrädern, muss rasch feststellen: Der Menschenschlag im Norden ist wie der stramme Gegenwind: Steif, sturmfest und wortkarg. Hier macht man wenig Worte. Geredet wird in dieser Welt eh zu viel.
In den letzten Augusttagen ziehen wir unsere Kreise durch Ostfriesland. Mit vollen Packtaschen, ohne Hilfsmotor. Hier gibt es keine Steigungen. Nur der Wind ist selten unser Freund, häufig bläst er hartnäckig ins Gesicht, zwingt letzte Reserven in die Pedale, während behelmte E-Bikende Rentner vorbeiziehen – auf den langen Geraden entlang der Kanäle zwischen Wiesmoor und Aurich.
Der beredte Guide vom Reiseveranstalter empfahl: In Ostfriesland am besten mit dem MAO-Motto reisen: Mund, Augen, Ohren auf. So funktionierts. Besser als jede App, die sowieso regelmäßig im Funkloch versinkt. Merkwürdig nur: Menschen trifft man kaum. Entweder rasen sie über die größeren Landstraßen, sitzen in Monster-Traktoren breit wie die Chaussee oder mähen stumpfsinnig ihre Rasen. In den Dörfern sind ständig Pflegedienste und Amazon im Einsatz. So passieren wir endlose Einfamilienhaus-Einöden. Klinkergebäude, Carport, große Vorgärten, Rasenroboter.
Die Wohnkultur auf dem Lande? Eine Selbstdarstellung der Bundesrepublik, wie sie leibt und lebt: Buchenhecken, Buchsbaum-Orgien, Wembley-Rasen, gepflasterte Zufahrten, Kiesornamente oder vergitterte Steinwälle. Ein Land, reicher denn je, präsentiert gestalterische Monotonie und Austauschbarkeit, soweit das Auge fällt. Manchmal ist ein Mensch zu sehen. Dann heißt es: Moin. Was sonst?
Nun gut. Ostfriesland rühmt sich für Bodenständigkeit, Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Abends gibt es ein Schnäpschen auf Kosten des Hauses. Die Alten erzählen von Sturmfluten, kalten Wintern und heizbaren Stövchen, das die Damen in der Kirche unter ihre Röcke platziert haben. Die Kirchen sind wie Trutzburgen, heute stehen sie meistens leer. Manche Türme sind windschief, weil der Boden „Pudding“ ist. Wenn im Laufe der Jahrhunderte das Eichenfundament vermodert, gibt es – schwups – eine neue Touristenattraktion wie in Suurhusen bei Emden. Der Kirchturm gilt als einer der schiefsten Türme der Welt. 2 Meter 47 Überhang. Jedes Jahr ein paar Zentimeter mehr. Mehr als in Pisa! Kein Gotteswille, kein Teufelswerk. Nein, schlicht der ostfriesische Untergrund. Marsch, Wasser, Moore. „Kannst nichts machen. Haste sonst noch Fragen?“
Was begeistert, ist die entspannte Ruhe. Der weite Blick. Die Weiden, Wiesen und Felder. Man spürt: Das Meer ist nah. Wolken wie Wattebäusche. Für Caspar David Friedrich symbolisierten Wolken stets das Göttliche. Eine Anekdote erzählt, dass seine Kinder jederzeit in sein Dresdner Atelier kommen durften, außer wenn er mit Himmelszeichnungen beschäftigt war. Maler-Ikone Friedrich war kein Ostfriese. Aber auch einer von der Küste. Von der Ostsee. Aus Pommern. Vom Menschenschlag scheinen sich Ostfriesen und Vorpommern nahe zu sein. Die gleiche Dickschädlichkeit, der gleiche trockene Humor. Nur nicht zu viel reden. Wortmüll gibt’s genug in dieser Welt. Moin, Moin! Und Tschüss.