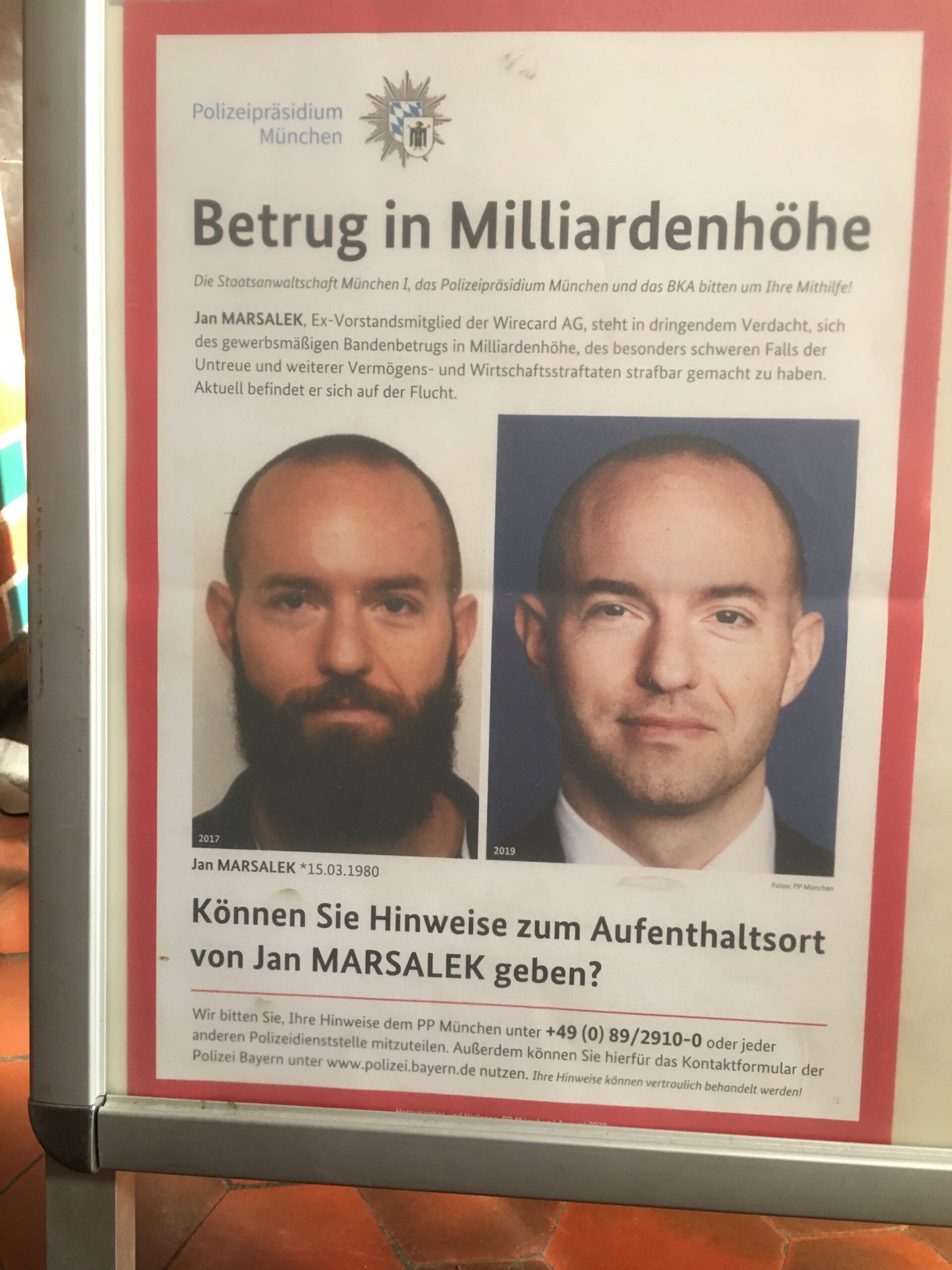„Weltaugenblick“
Berlin in einer kalten Januarnacht 1919: „Abends in einem Kabarett in der Bellevue Straße. Rassige spanische Tänzerin. In ihre Nummer krachte ein Schuss hinein. Niemand achtete darauf. Geringer Eindruck der Revolution auf das großstädtische Leben“. Schüsse und Straßenschlachten betrachten die feierwütigen Bohemiens allenfalls als lästige Störung, „wie wenn ein Elefant einen Stich mit einem Taschenmesser bekommt“, notiert der Gesellschaftsbeobachter Harry Graf Kessler Anfang der zwanziger Jahre.
Exakt vor hundert Jahren am 1. Oktober 1920 lernt Groß-Berlin – wie wir es heute kennen – das Laufen. Acht selbständige Städte, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke sind per Gesetz zusammengeschlossen worden. Über Nacht katapultiert sich diese Ansammlung von märkischen Dörfern zur drittgrößten Metropole der Welt nach New York und London. Für den neuen Einheitstarif von 20 Pfennige geht es nun durch die neue Riesenstadt, von Spandau bis nach Köpenick. Von Elendsquartieren im Wedding bis hinaus zu den Luxusvillen im Grunewald. So viel Neuanfang in Berlin. Der Tanz auf dem Vulkan beginnt trotz Kriegsniederlage, Inflation, Streiks, Massenarmut und einer wütenden Spanischen Grippe, die in der Stadt Hunderttausende wegrafft.
Der Kaiser hat abgedankt. Die Hauptstadt der neuen Republik gleicht einem brodelnden Kessel. „Babylon Berlin“ produziert täglich einen Overkill an Kunst, Kultur, Vergnügen, Demos und Druck. Tempo, Tempo, aus dem Weg, heißt die Devise. Wer sich durchsetzen will, braucht Einfallsreichtum und das Glücksmoment des richtigen Augenblicks. Die Zwanziger werden das „Jahrzehnt Berlins“. Im Kessel ist Dampf und wie ein Chronist notiert: „Wer den Kessel heizte, sah man nicht; man sah ihn nur lustig brodeln und fühlte die immer stärker werdende Hitze. An allen Ecken standen Redner. Überall erschollen Hassgesänge. Alle wurden gehasst: die Juden, die Kapitalisten, die Junker, die Kommunisten, das Militär, die Hausbesitzer, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die Schwarze Reichswehr, die Kontrollkommissionen, die Politiker, die Warenhäuser und nochmals die Juden. Es war eine Orgie der Verhetzung, und die Republik war schwach, kaum wahrnehmbar.“
Anfang der Zwanziger Jahre zeigen in der Stadt 328 Kinos neueste Filme. 23 Theater mit über 1.000 Plätzen konkurrieren um das amüsierfreudige Publikum. 1925 zählt die Hauptstadt 928 Verlage und 1.879 Buchhandlungen. Was bedeutet das? Auffallen um jeden Preis. Ob Theater, Tanz, Film, Revue oder Swing, Hauptsache es ist modern, „glänzt und spritzt“, wie es Alfred Döblin („Berlin-Alexanderplatz“) so schön ausdrückt. Sein Schriftstellerkollege Canetti, der spätere Nobelpreisträger legt in seiner Fackel im Ohr noch eins drauf: „Jeder einzelne, der etwas war, und viele waren etwas, schlug mit sich auf die anderen los.“
„Hure Babylon“ zetern verwirrte Konservative und entsetzte Nationalisten. Und doch gehen viele abends in Kaschemmen und Tingeltangel-Theater. Legendär ist die Figur des Professors Unrat, der sich im „Blauen Engel“ an der feschen Lola Marlene Dietrich gehörig die Finger verbrennt. Nie zuvor und nie danach ist die Stadt so wichtig für die Künste. Zwischen 1919 und 1932 erlebt Berlin „ihren Weltaugenblick als Stadt der Künstler und Zentrum der ästhetischen Moderne“, notiert Jens Bisky in seiner wunderbaren Berlin-Biografie.
In diesen Tagen könnte „Groß-Berlin“ seinen hundertsten Geburtstag feiern. Könnte. Mit Staatsakt und Feuerwerk. Doch Corona vermasselt die Party. Was bleibt? Der schillernde Babylon-Mythos überlebte Kriege, Nazi-Katastrophe, Trümmer, Mauer und neue Blüte als Start-up-Hipster-Hotspot. Berlin bleibt ein Sehnsuchtsort für alle, die ihr Leben selbst definieren. Der Preis? Jede und jeder braucht ein dickes Fell in einer Stadt, in der eine überforderte Verwaltung und gestresstes Führungspersonal Normalzustand waren und sind.
Nichts funktioniert richtig und doch wollen so viele nach Berlin.