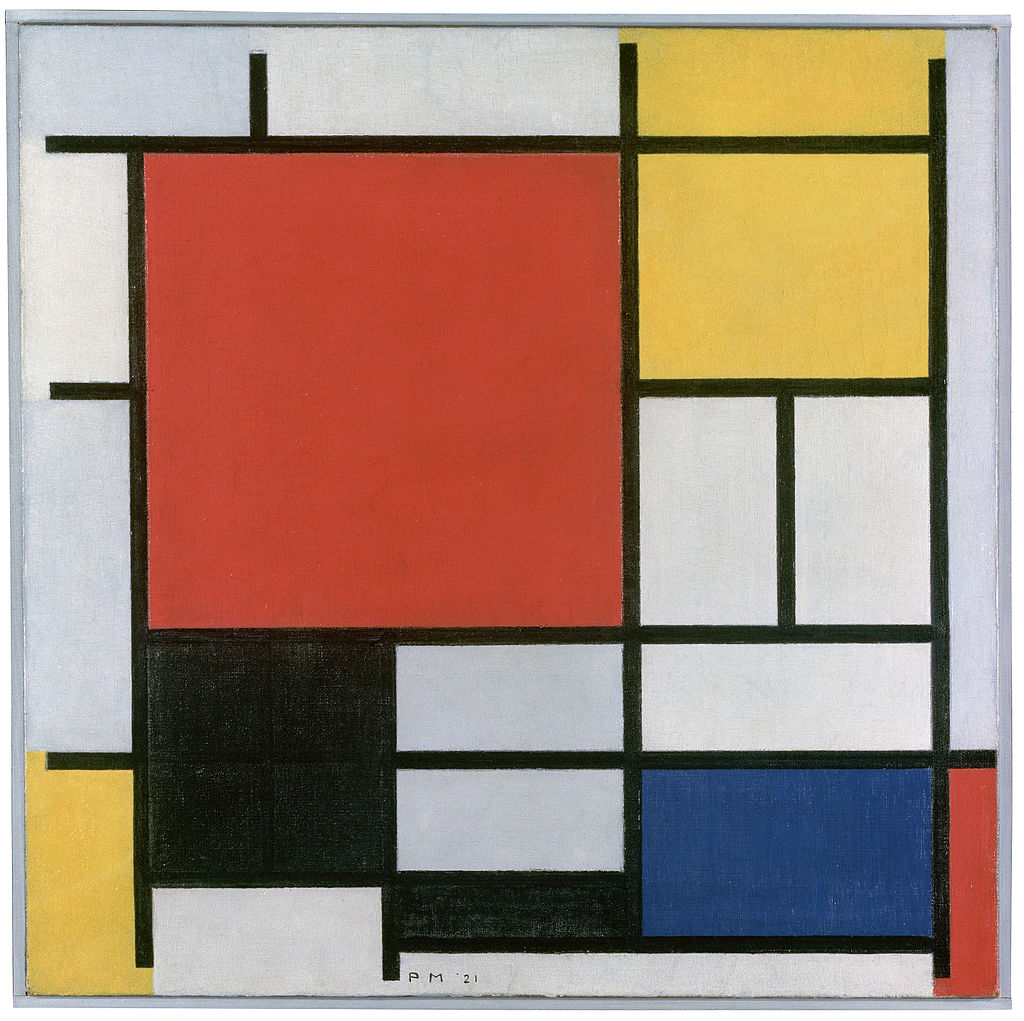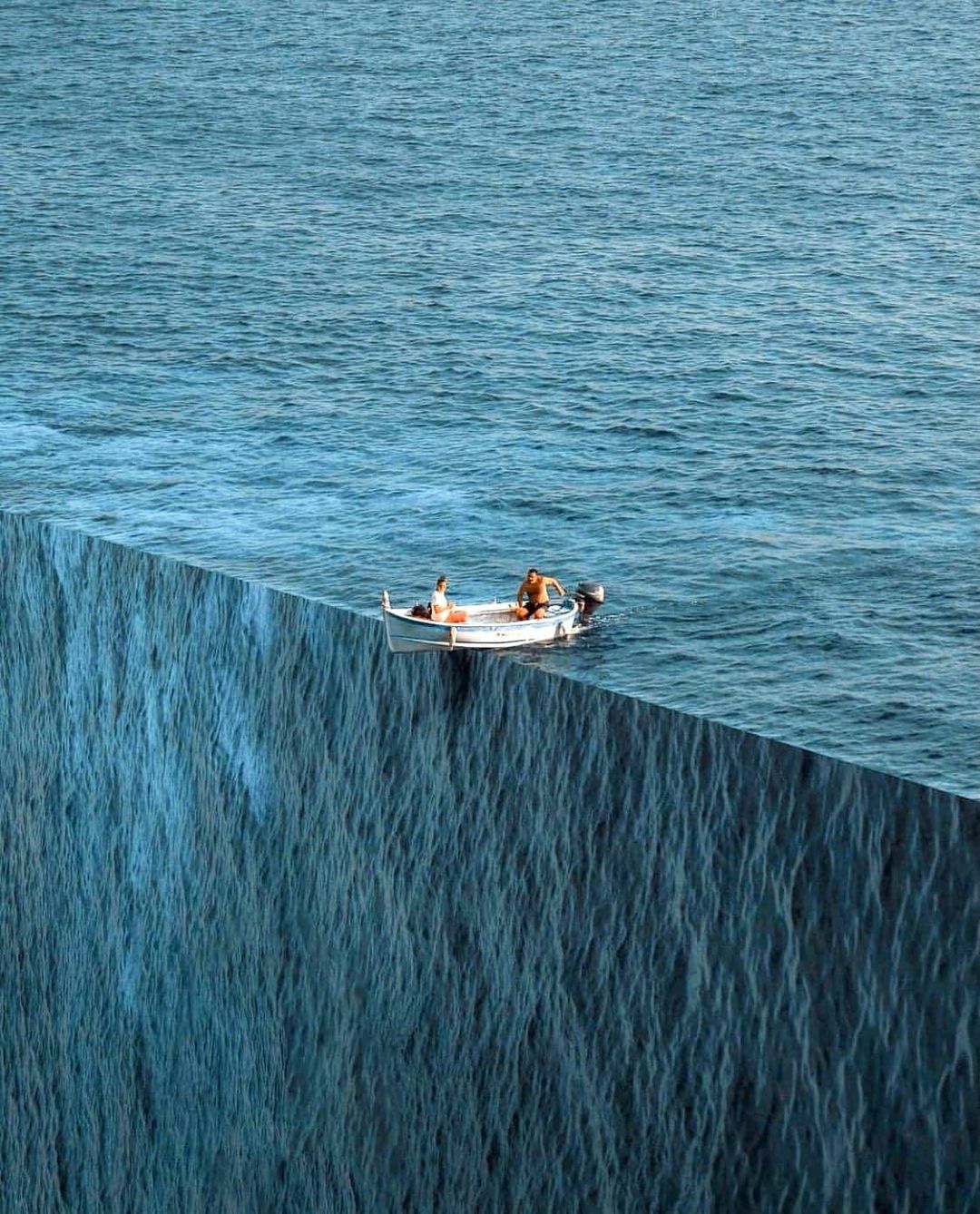„Jetzt kommen neue Zeiten“
Posted on: 7. November 2020 /
Heils- und Hassprediger fahren in diesen Tagen Sonderschichten. Im Internet – unserer Neuen Heimat – verbreiten sich Spreader aller Farben, Formen und Fähigkeiten. Sie zeigen mit dem Finger auf andere ohne rot zu werden, Zynismus geht besonders gut. Entertaiment at it´s best. Wir amüsieren uns zu Tode. Der US-Medienwissenschaftler Neil Postman bemerkte: „Jeder Trottel kann ein Star werden, das ist das Grundprinzip. Es ergibt sich eine doppelte Perspektive. Der Zuschauer kann sich in das Geschehen hineinträumen, er wolle ein Star werden, und er nimmt am Selektionsprinzip teil. Ein gemachter Superstar, eine Schöpfung aus dem Nichts“. Postmans Zeilen sind 35 Jahre alt. Das Internet kannte er nicht, es steckte noch in den Kinderschuhen.
Mitten in unserer zweiten Lockdown-Isolations-Zeit habe ich eine bemerkenswerte Perle in den Tiefen des Internets gefunden. Die Geschichte hat mich so berührt, dass ich sie gerne teilen möchte.
Jetzt kommen neue Zeiten, schreibt Olga Tokarczuk aus Breslau, den Grenzen geht es gerade wieder sehr gut und die Schlacht um eine neue Wirklichkeit wird bald beginnen. Die scheue polnische Literaturnobelpreisträgerin veröffentlichte diesen Text im April 2020 während des ersten Stillstandes. Knapp zehn Minuten Lebenszeit sind vonnöten. Es lohnt sich. Versprochen.
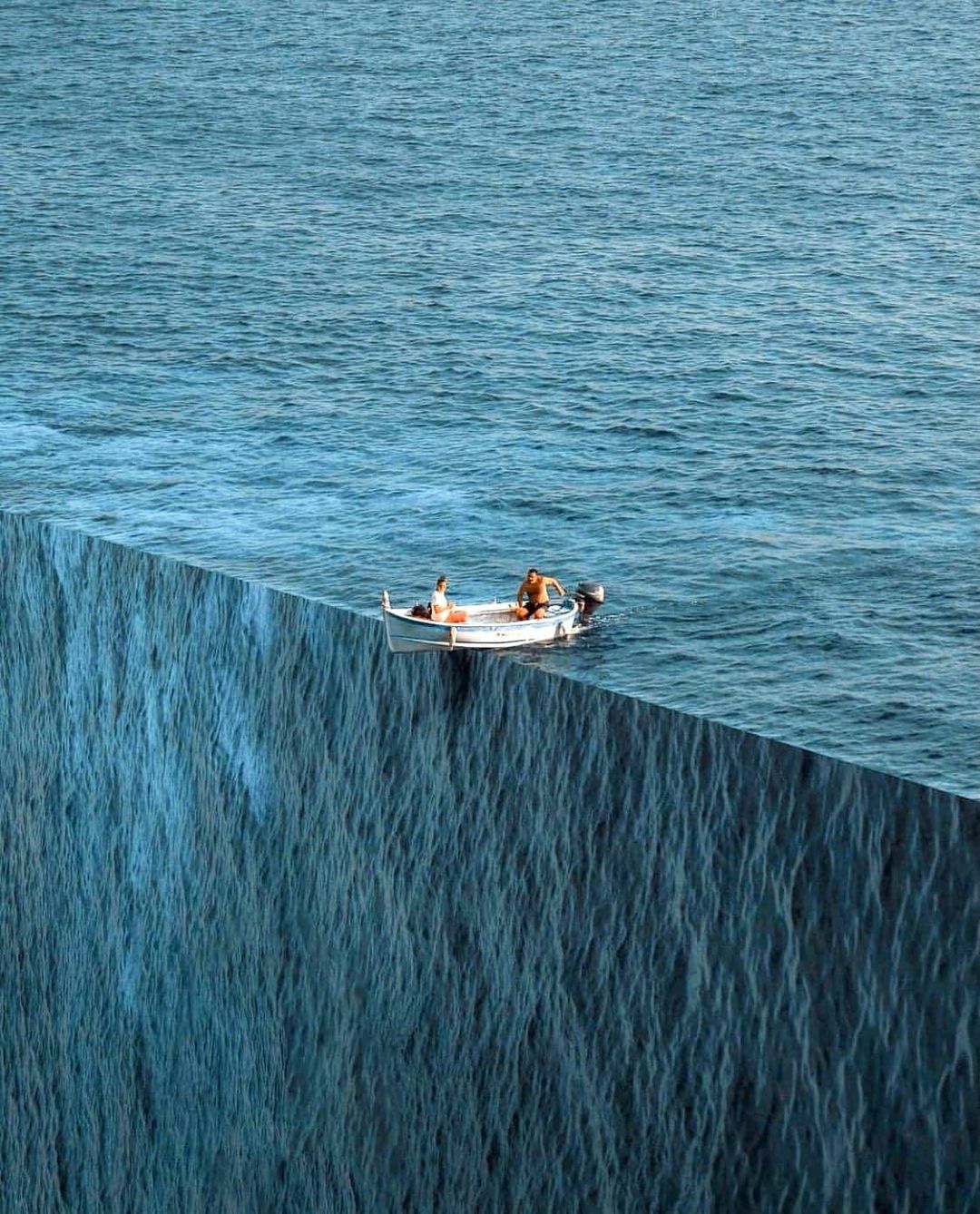
„Aus meinem Fenster sehe ich eine Weiße Maulbeere, einen Baum, der mich fasziniert; er war einer der Gründe, warum ich hier eingezogen bin. Der Maulbeerbaum ist ein freigiebiges Gewächs: den ganzen Frühling und den ganzen Sommer über ernährt er Dutzende Vogelfamilien mit seinen süßen, gesunden Früchten. Jetzt aber trägt der Baum keine Blätter; so sehe ich ein ruhiges Stück Straße, die nur selten jemand entlanggeht, um in den Park zu gelangen. Das Wetter ist in Breslau fast sommerlich, die Sonne blendet, der Himmel ist blau, und die Luft ist rein.
Heute sah ich, als ich mit meinem Hund spazieren ging, wie zwei Elstern eine Eule von ihrem Nest vertrieben. Die Eule und ich, wir sahen uns aus kaum einem Meter Entfernung in die Augen. Mir scheint, auch die Tiere warten auf das, was auf uns zukommt. Ich hatte schon seit längerem zu viel Welt um mich herum. Zu viel, zu schnell, zu laut. Daher habe ich jetzt kein „Trauma der Isolation“; ich leide nicht darunter, dass ich mich nicht mit Menschen treffe. Ich bedauere nicht, dass die Kinos geschlossen sind, es ist mir gleichgültig, dass die Shopping-Malls außer Betrieb sind. Es sei denn, ich denke an all jene, die dort jetzt ihren Arbeitsplatz verloren haben. Als ich von der präventiven Quarantäne hörte, verspürte ich eine Art von Erleichterung, und ich weiß, dass viele ähnlich empfinden, auch wenn sie sich dessen schämen. So hat meine Introversion, die lange unter dem Diktat hyperaktiver Extrovertierter gelitten hatte, ja fast erstickt worden war, den Staub abgeschüttelt und ist aus dem Keller hervorgekommen.

Berlin im November 2020.
Durch das Fenster sehe ich meinen Nachbarn, einen überarbeiteten Juristen. Bis vor kurzem sah ich ihn immer morgens, wie er mit der Robe über dem Arm ins Gericht fuhr. Jetzt steht er in einem sackförmigen Trainingsanzug im Garten und müht sich mit einem Ast; offenbar will er aufräumen. Ich sehe ein junges Paar, wie es seinen alten Hund ausführt, der kaum noch laufen kann. Der Hund schwankt hin und her, und die jungen Menschen begleiten ihn geduldig und gehen so langsam wie möglich. Derweil holt die Müllabfuhr mit großem Lärm den Müll ab.
Das Leben geht weiter, na klar doch, aber in einem ganz anderen Takt. Ich habe den Schrank aufgeräumt und die gelesenen Zeitungen zum Papiercontainer gebracht. Ich habe die Blumen umgetopft. Ich habe das Fahrrad von der Reparatur abgeholt. Freude bereitet mir das Kochen. Immer wieder tauchen Bilder aus der Kindheit in mir auf, als es viel mehr Zeit gab und man sie „verschwenden“ durfte, indem man stundenlang aus dem Fenster schaute, die Ameisen beobachtete, unter dem Tisch lag und sich vorstellte, er sei eine Arche. Oder indem man die Enzyklopädie las. Ist es nicht so, dass wir zum normalen
Lebensrhythmus zurückgekehrt sind? Dass nicht das Virus die Norm verletzt, sondern umgekehrt: dass jene hektische Welt vor dem Virus nicht normal war? Schließlich hat der Virus uns ins Gedächtnis gerufen, was wir so leidenschaftlich verdrängt hatten: dass wir fragile Wesen sind, gebaut aus der zartesten Materie. Dass wir sterben, dass wir sterblich sind.
Dass wir von der Welt nicht durch unser „Menschentum“ und unsere Außergewöhnlichkeit geschieden sind, sondern dass die Welt eine Art großes Netz ist, in dem wir hängen, mit anderen Wesen durch unsichtbare Fäden von Abhängigkeit und Einfluss verknüpft. Dass wir voneinander abhängig sind und dass wir ganz gleich, aus wie fernen Ländern wir stammen‘, welche Sprache wir sprechen und welches unsere Hautfarbe ist -genauso krank werden, genauso Angst haben und genauso sterben. Es hat uns klargemacht, dass – ganz gleich, wie schwach und wehrlos wir uns angesichts der Gefahr fühlen – Menschen um uns herum sind, die noch schwächer sind und die Hilfe brauchen. Es hat uns in Erinnerung gerufen, wie zart unsere alten Eltern und Großeltern sind und wie sehr sie unsere Fürsorge verdient haben. Das Virus hat uns gezeigt, dass unsere fieberhafte Mobilität die Welt bedroht. Und es hat die Frage aufgerufen, die wir uns nur selten zu stellen wagten:
Was suchen wir eigentlich?
Die Angst vor der Krankheit hat uns also von unserem verschlungenen Weg zurückgeführt und uns daran erinnert, dass es Nester gibt, aus denen wir stammen und in denen wir uns sicher fühlen. Und selbst wenn wir die größten Weltreisenden wären – in einer Lage wie dieser werden wir immer zu einer Art von Zuhause streben. Damit haben sich uns auch traurige Wahrheiten offenbart: dass im Augenblick der Gefahr das Denken in abschließenden und ausgrenzenden Kategorien zurückkehrt, in den Kategorien von Völkern und Grenzen.
In diesem schwierigen Augenblick zeigte sich, wie schwach die Idee einer europäischen Gemeinschaft in der Praxis ist. Die EU hat im Grunde kapituliert und es den Nationalstaaten überlassen, in dieser Krisenzeit Entscheidungen zu fällen. Die Schließung der Grenzen halte ich für die größte Niederlage in diesen schlechten Zeiten; zurückgekehrt sind die alten Egoismen und die Kategorien „eigen“ und „fremd“, jenes also, was wir in der Hoffnung bekämpft hatten, dass es nie wieder unser Denken formatieren würde. Die Angst vor dem Virus hat automatisch die einfachste, atavistische Überzeugung wachgerufen, ,,Fremde“ seien schuld und sie würden immer Gefahren mitbringen. Nach Europa kam das Virus „von außen“, es ist nicht unser, es ist fremd. In Polen gerieten alle in Verdacht, die aus dem Ausland heimkehrten.
Die vielen Grenzen, die zugeknallt wurden, und die riesigen Schlangen an den Grenzübergängen waren sicher für viele junge Menschen ein Schock. Das Virus erinnert uns: Die Grenzen existieren weiter, es geht ihnen gut. Ich fürchte, das Virus wird uns noch eine andere alte Wahrheit in Erinnerung rufen: wie sehr wir einander nicht gleich sind. Die einen unter uns werden mit ihrem Privatflugzeug in ihr Haus auf der Insel fliegen oder in der Einsamkeit des Waldes sein können. Andere werden in den Städten bleiben, um Elektrizitätswerke und Wasserleitungen am Laufen zu halten. Wieder andere werden bei der Arbeit in Läden und Krankenhäusern ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Die einen werden an der Epidemie verdienen, die anderen werden ihre Ersparnisse verlieren. Die nahende Krise wird wahrscheinlich die Spielregeln, die uns so stabil erschienen, außer Kraft setzen; viele Staaten werden mit der Krise nicht fertig werden, und aufgrund ihrer Auflösung wird eine neue Ordnung zum Leben erwachen, wie es nach Krisen oft der Fall ist.
Wir sitzen zu Hause, lesen Bücher und schauen Serien, aber in Wirklichkeit bereiten wir uns auf die Schlacht um eine neue Wirklichkeit vor, die wir uns noch nicht einmal vorstellen ‚können; nur beginnen wir langsam zu begreifen, dass nichts mehr so sein wird, wie es war. Die Zwangsquarantäne und die Kasernierung der Familie im Haus kann uns bewusst machen, was wir nur ungern zugeben würden: dass die Familie uns auf die Nerven geht, dass das Band der Ehe längst zerbröselt ist. Unsere Kinder werden die Quarantäne als Internet-Abhängige verlassen, und vielen von uns wird die Sinn- und Nutzlosigkeit der
Lage klar werden, in der sie rein mechanisch, aufgrund der Trägheit der Masse, stecken. Und was wird mit uns sein, wenn die Zahl der Morde, Selbstmorde und psychischen Krankheiten zunimmt?
Vor unseren Augen verfliegt, verraucht in Paradigma der Zivilisation, das uns über die letzten zweihundert Jahre geformt hat. Es lautete: Wir sind die Herren der Schöpfung, wir können alles, und die Welt gehört uns. Jetzt kommen neue Zeiten.“
Olga Tokarczuk. Nobelpreisträgerin für Literatur. „Die Jakobsbücher“. „Ein geniales literatisch-philosophisches Großwerk.“ Iris Radisch, Die ZEIT.