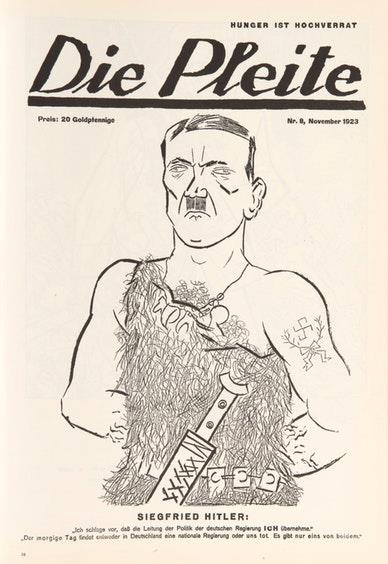Als die Queen Schiller besuchte
24. Mai 1965. Ein Tag, den ich nie vergessen werde. Es ist bedeckt und leicht regnerisch, als meine Mutter und deren Freundin mit mir, dem siebenjährigen Steppke, zur Protokollstrecke Stuttgart – Ludwigsburg – Marbach eilen. Die Queen ist in Deutschland. Welch ein Glanz! Was für ein Ereignis! Ich habe Herzklopfen und zwei selbst gebastelte Union Jack-Fähnchen dabei. Die will ich begeistert schwenken, wenn sie im offenen Mercedes S 600 Pullmann auf ihrem Weg zur Schillerstadt Marbach vorbeikommt. Das muss man sich vorstellen: Queen Elisabeth II aus dem Hause Windsor und Prinz Philip Herzog von Edinburgh bei uns! Höchstpersönlich. Auf ihrer ersten Deutschland-Reise nach dem Krieg. Eine Premiere. Das Königspaar aus dem Vereinten Königsreich beehrt für elf Tage unser besiegtes, westliches Wirtschaftswunderland. Ich bin mehr als mächtig aufgeregt.
 24. Mai 1965. Queen Elisabeth II im offenen Mercedes auf ihrem Weg durch Stuttgart.
24. Mai 1965. Queen Elisabeth II im offenen Mercedes auf ihrem Weg durch Stuttgart.
Lange vor dem angekündigten Termin stehen wir auf der „richtigen“ Straßenseite, an der die Queen am besten zu sehen sein soll. Sie wird hinten rechts sitzen, heißt es, ihr Gemahl Prinz Philip auf der linken Seite. Eine große Menschenmenge ist zusammengelaufen. Alle sind aufgekratzt, schnattern fröhlich. Die Polizei räumt eine breite Gasse frei. Das Warten gerinnt zu einer gefühlten Ewigkeit. Aus Minuten werden Stunden. Da heißt es, die Queen verspäte sich. Gerüchte verbreiten sich. Der 39-jährigen sei angeblich unwohl geworden, weiß jemand, oder die Luxuslimousine sei stehengeblieben. Kaum vorstellbar, aber dieses Gerücht sollte sich später bewahrheiten. Der schwere Mercedes Pullmann versagte in Stuttgart den Dienst. Er musste unter dem Gejohle der Zuschauer von den Chauffeuren angeschoben werden. Welch ein Schmach in der stolzen Wir-sind-wieder-wer-Daimlerstadt!
Plötzlich kommt Bewegung in die Menge. „Die Queen kommt!“, ruft ein Mann, der hinter uns auf einer Leiter steht. Die Menschen rufen wie auf Kommando Hurra. Ich stehe als kleiner Bub in Sonntagsstaat mit meinen Fähnchen bereit für den großen Augenblick. Da drängelt und schubst jemand. Meine beiden Wachsstift-bemalten Union Jack-Fahnen fallen auf das Straßenpflaster. Um Himmels willen! Die Jubelschreie steigern sich zu einem Orkan. Ich versuche im nervösen Gedränge meine Fähnchen zu retten, als ich das Brummen der Motoradstaffel – meine Mutter nannte sie „weiße Mäuse“ – und den tiefen Sound der schweren Mercedes-Limousinen höre. Als ich wieder aufrecht stehe und gleichfalls meine Fähnchen schwenke, ist der Pullmann-Mercedes mit der Queen längst vorbei. Ich sehe nur noch schwarze Begleitfahrzeuge von hinten. Unfassbar.

Eine Viertelstunde, nachdem ich die Queen verpasst habe, gelingt einem Amateurfotografen in Marbach diese Aufnahme. Die Queen in Schillers Geburtsstadt. Leserfoto Jones.
Meine Mutter lacht. Sie strahlt vor Glück. „Ich habe sie gesehen. Sie hatte einen gelben Hut und ein gelbes Chrysanthemen-Kleid an“. Chrysanthemen sind mir in diesem Moment historischen Versagens schnuppe. Ich war bei der Queen und habe sie verpasst. Schlimmer noch: Meiner Tante gelang 1965 ein Schwarz-Weiß-Foto. Unscharf ist die Queen im Fond zu erkennen. Auch dieser Beleg, dass die Queen bei uns vorbeikam, ist verschwunden. Was ich im siebzigsten Dienstjahr der Queen noch erwähnen möchte. Sie hat sich für den Dichter Schiller, den ich verehre, zehn Minuten Zeit genommen. Sie studierte einige Handschriften, staunte über die bescheidene Küche. Sie lobte den guten Zustand von Schillers Geburtshaus. Kein Wunder. Die Marbacher hatten das Haus komplett renoviert und aufgehübscht. Geschmückt mit Chrysanthemen-Sträußen. Gelb wie Hut und Kleid der Queen, die ich an diesem Mainachmittag des Jahres 1965 verpasst habe.