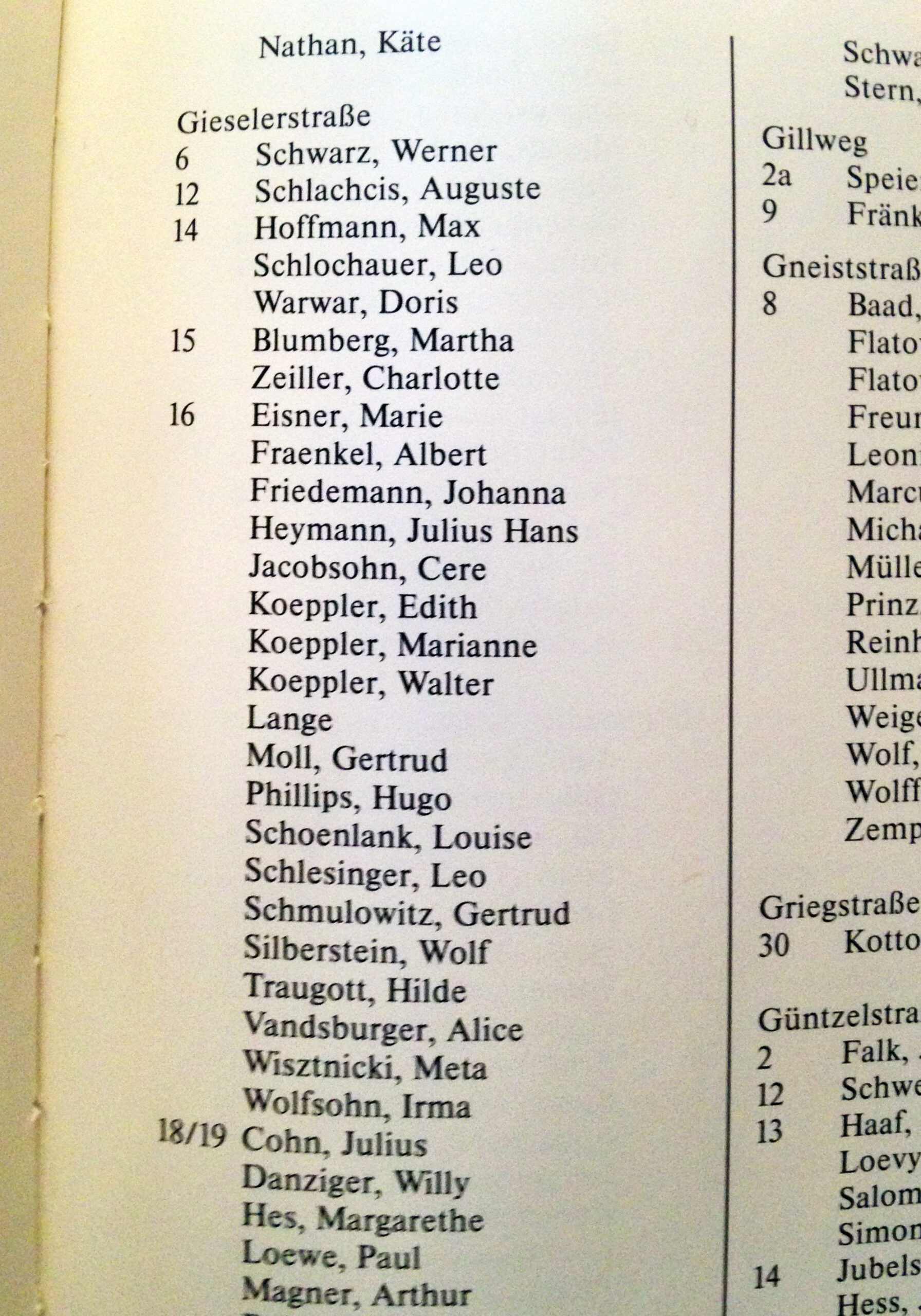Für ein Stück Brot
Endlich ist sie wieder da. Die kleine Gedenktafel, die an einen vergessenen Aufruhr von großer Tragik erinnern soll. Viele Jahre war das blau-weiße Emaille-Erinnerungs-Stück für zwei hingerichtete Menschen verschwunden. Eine Tafel für Menschen, die in den letzten Kriegstagen in Plötzensee unter dem Fallbeil sterben mussten, weil sie Brot wollten. Einfach nur ein Stück Brot. Brot, das kurz vor Kriegsende 1945 in Berlin nur noch an NS-Genossen verkauft werden durfte, um den „Endsieg“ zu sichern. Verschwunden war die alte blau-weiße Tafel von 1998, weil der neue Eigentümer die Bäckerei kaufte, sanierte und für die Wiederanbringung keine Notwendigkeit sah. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Es dauerte auch so viele Jahre, weil die Berliner Bürokratie unschlagbar ist: im Nichtzuständig-Erklären, in großen Reden und im wurstigen Aussitzen.

Happy End nach langem Ringen. Die neue Gedenktafel vor der ehem. Bäckerei Deter in Berlin-Rahnsdorf. Carolin Weingart, stellv. Bezirksbürgermeisterin von Treptow-Köpenick, Dunja Wolff (SPD-Abgeordnete), Dietrich Elchlepp (Freiburg, ehem. MdB + MdEP, Angehöriger) und Gion Voges (Bürger für Rahnsdorf)
Jetzt steht wieder eine Gedenktafel vor der ehemaligen Bäckerei. Sie wurde vom tüchtigen Vorsitzenden des Bürgervereins Rahnsdorf Gion Voges und Dietrich Elchlepp, dem Freiburger Neffen der hingerichteten Margarete Elchlepp eingeweiht. Mit dabei waren einige Vertreterinnen des zuständigen Bezirksamtes Treptow-Köpenick, dazu eine Abgeordnete der SPD, sogar der Hauseigentümer und Bürgerinnen und Bürger des Berliner Vororts Rahnsdorf. Allesamt froren. Denn es war kalt an diesem Novembertag, neblig und trübe. Die Musiker trotzten tapfer den widrigen Bedingungen. „Eine Gedenkfeier auf einem Parkplatz, aber eine würdige Sache“, meinte eine Teilnehmerin.
Die Tafel erinnert an den 6. April 1945. An diesem Freitag, vier Wochen vor Kriegsende, schnappt schicksalhaft die ganze Grausamkeit des NS-Regimes in einer kleinen Bäckerei zu. In Rahnsdorf, ein ländlicher Vorort im Osten Berlins, geht das Brot aus. Verzweifelt drängen mehrere hundert Menschen, vor allem Frauen, in die Verkaufsstellen. Der alarmierte NS-Ortsgruppenführer geht dazwischen. Mit gezückter Waffe drängt er in der Bäckerei Deter die Menge zurück. Die Rache des Regimes folgt auf den Fuß. Systemtreue Frauen stellen Listen zusammen. Die Gestapo verhaftet 15 Personen. Am Tag darauf werden die 45-jährige Hausfrau Margarete Elchlepp und der 54-jährige Tischlermeister Max Hilliges in Plötzensee als „Rädelsführer“ enthauptet.

Berliner Gedenktafel für die Opfer des „Rahnsdorfer Brotaufstands“. Enthüllt am 25.11.2022. Zugegeben: ich wäre gerne dabei gewesen, aber eine Bronchitis setzte klare Grenzen.
Nur zwei Wochen später marschiert die Rote Armee ein. Der NS-Ortsgruppenführer wird von den Sowjets wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erschossen. Die neue Stadtverwaltung ermittelt bis 1952 zum sogenannten Brotaufruhr von Rahnsdorf. Nun werden die Denunzianten selbst denunziert. Gegen acht Helferhelfers des NS-Ortsgruppenleiters wird ermittelt, eine Frau zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Danach legt sich der Mantel des Schweigens über die Sache mit dem „Brotaufruhr“. In den Familien bleibt das Drama ein gut gehütetes Geheimnis – bis in unsere Tage. Ich erfuhr von meinem Schwiegervater vom vergessenen Brotaufstand. Auf seinem Sterbebett bat er 2018, mich der Sache mit der verschwundenen Gedenktafel anzunehmen, die er 1998 mit enthüllt hatte.

Margarete Elchlepp (1899-1945). Sie gab im Verhör zu, ein Brot mitgenommen zu haben. Margarete wurde als „Rädelsführerin“ verurteilt. Sie wurde in Plötzensee am 8. April um 0.45 Uhr enthauptet. Die letzten Todesurteile wurden am 18. April 1945 vollzogen.

Tischlermeister Max Hilliges. Er war mit Reparaturen in der Bäckerei beschäftigt, als die Menge den Laden stürmte. Hilliges sagte dem NS-Mann Gathemann, der die Pistole gezogen hatte: „Gib den Frauen Brot.“ Und: „Du wirst Deinen braunen Rock bald auch ausziehen müssen“, so Witwe Elise 1947 bei einer Vernehmung.
Jetzt erinnert wieder eine Tafel an diese winzige Begebenheit im großen Strom der Menschheitsgeschichte, die davon erzählt, wozu verzweifelte Menschen in der Lage sind. Möge die Tafel lange stehen bleiben. Möge sich so etwas nie wiederholen. Möge es immer Brot für alle geben.