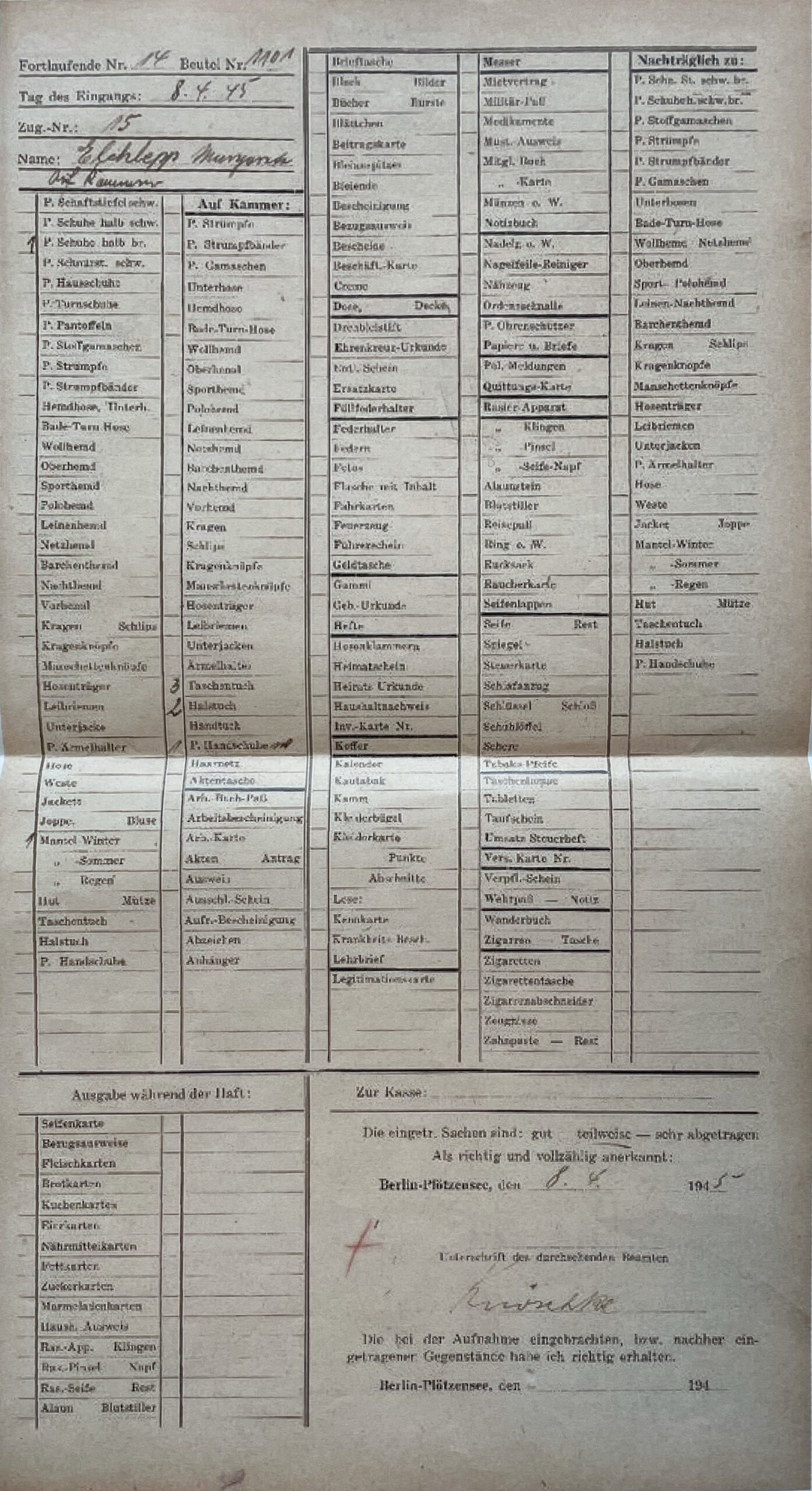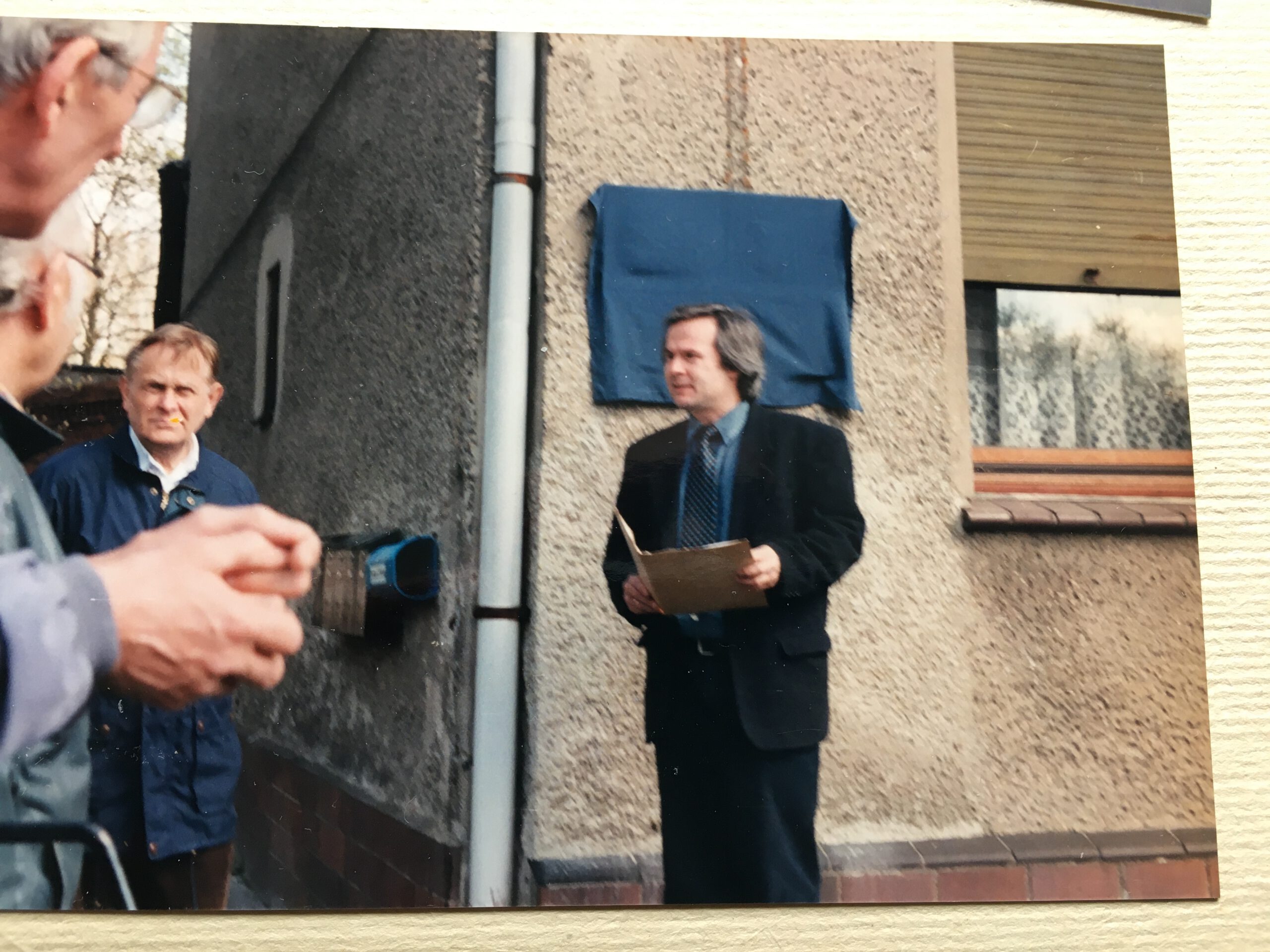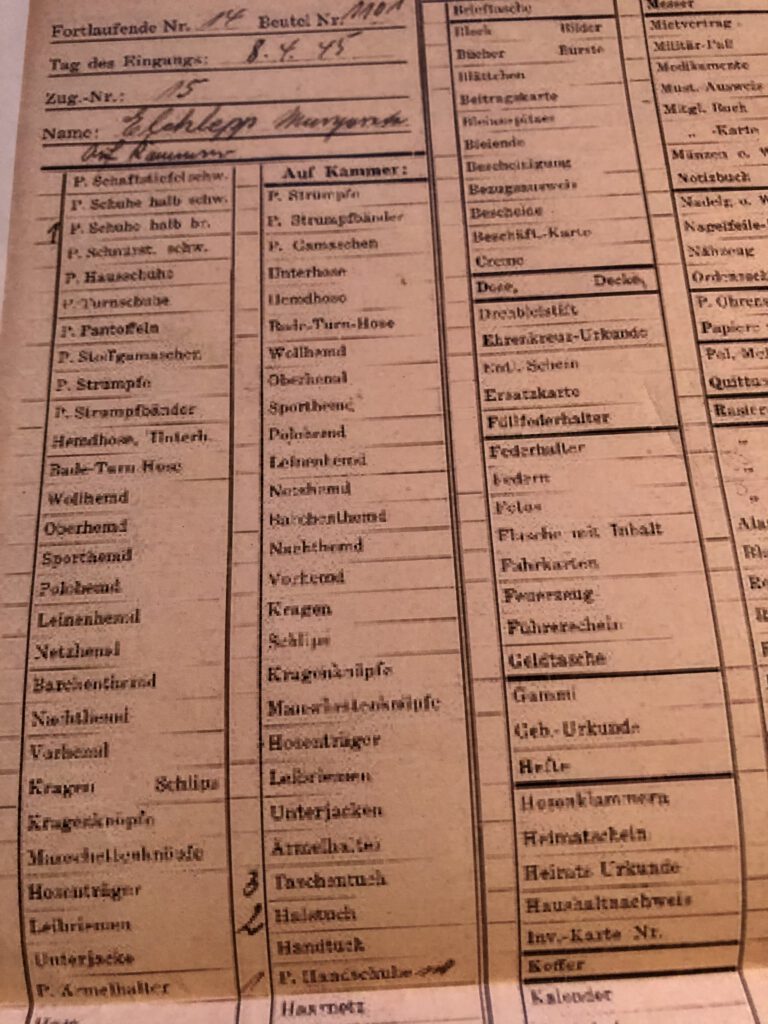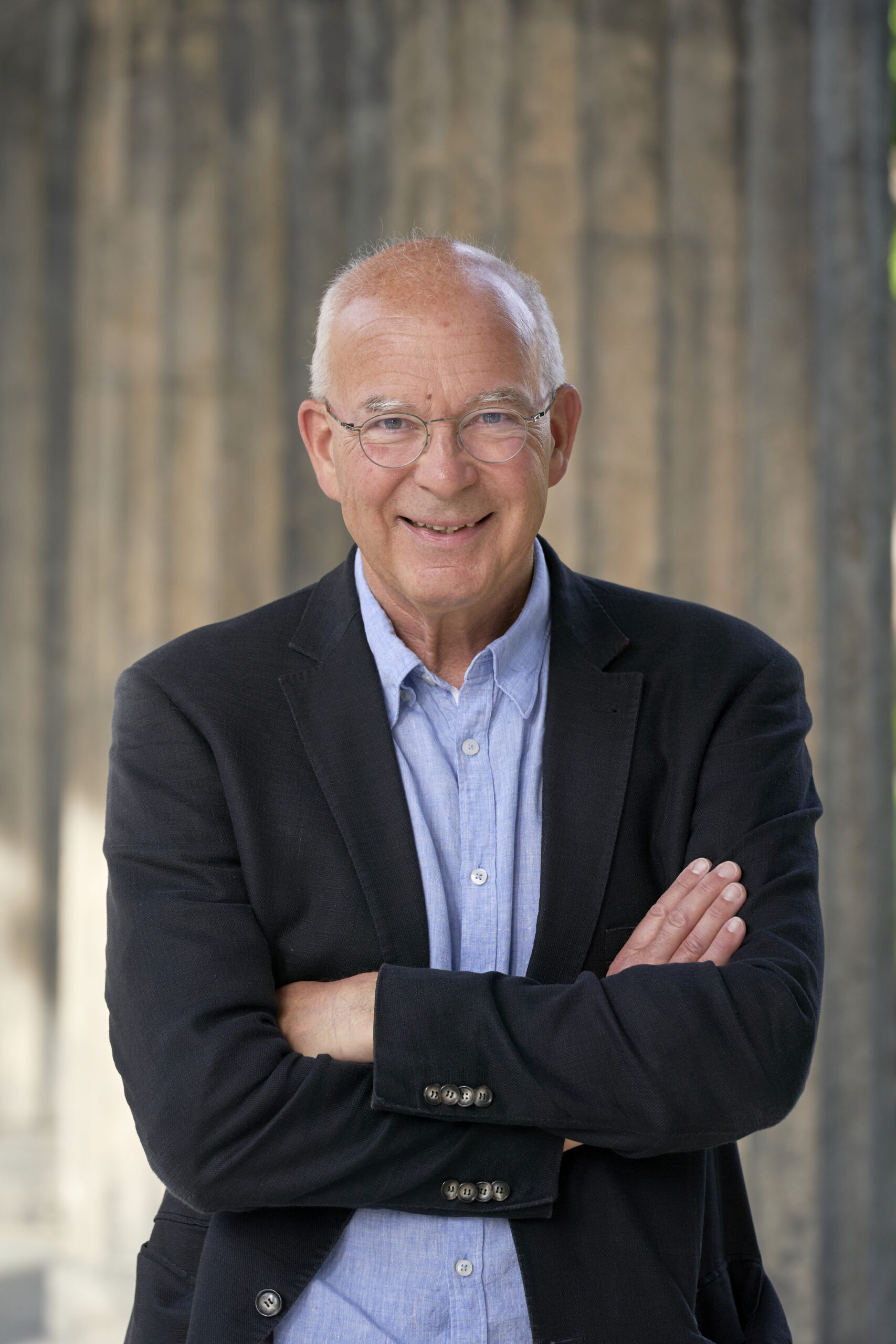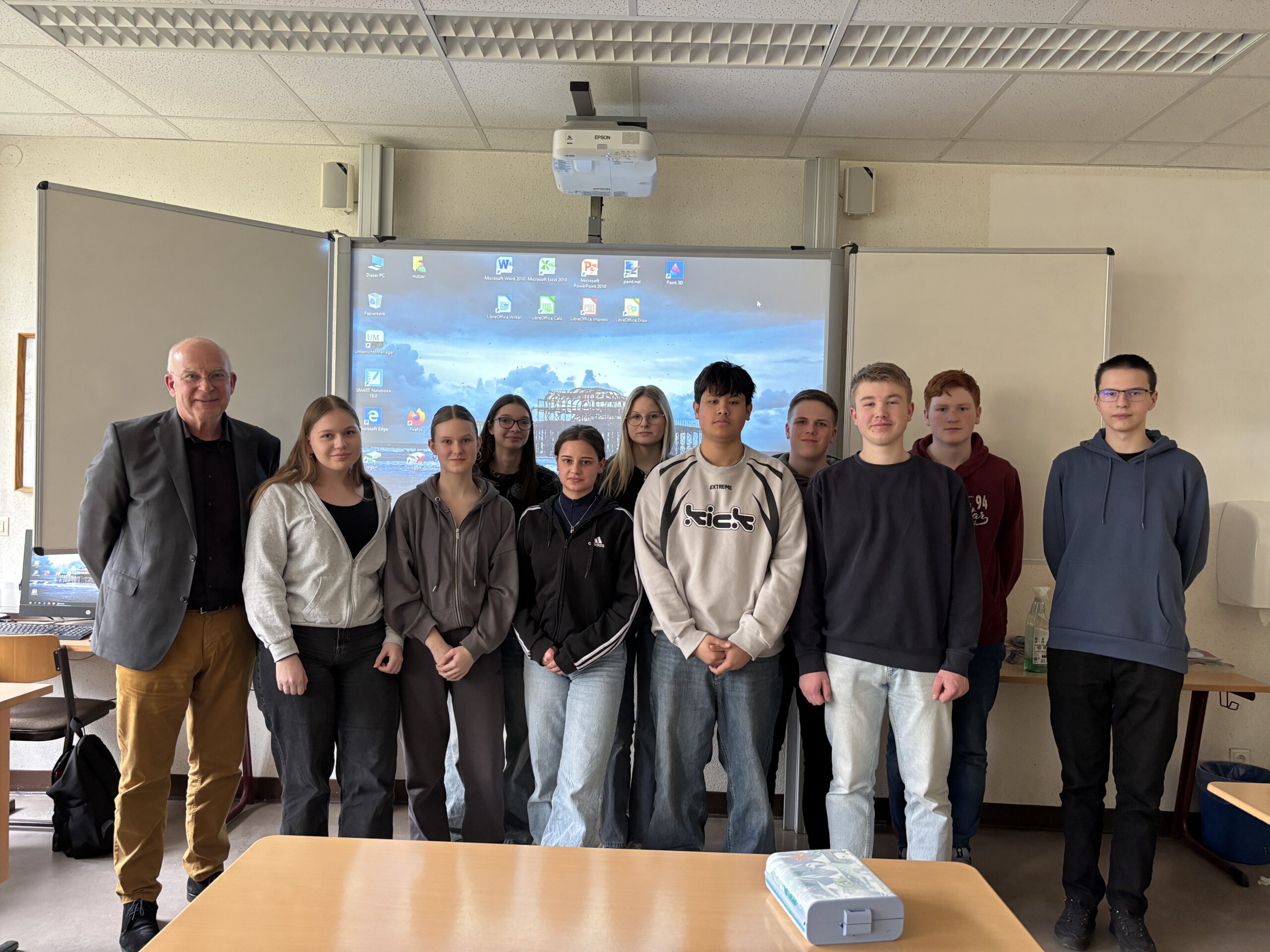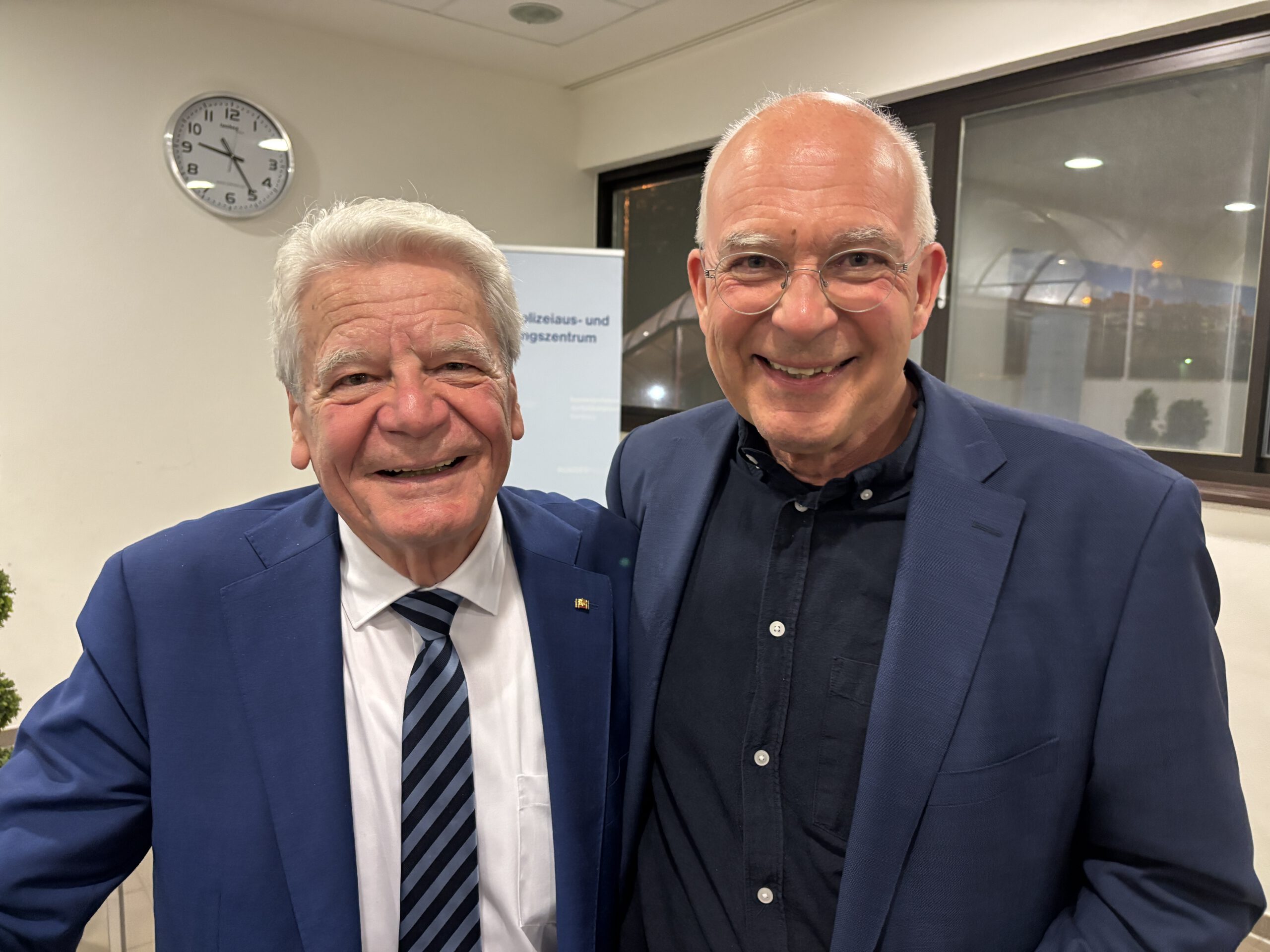Morgentau
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute 16.07.2025
Claus Peymann ist tot
Einer der Großen des Theaters hat die Bühne verlassen
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 23.05.2024
Ein Provisorium wird 75
Stimmen zum Grundgesetz
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 23.05.2024
75 Jahre Grundgesetz – Kulturzeit extra
Demokratiefördergesetz und Meinungsfreiheit
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.05.2024
Wer Tuba spielt, hat mehr vom Leben
Die Tuba ist Instrument des Jahres
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Mittagsmagazin 10.05.2024
Erfolgsgeschichten aus dem Osten (ab 01.31.53)
Union Berlin
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Volle Kanne 06.05.2024
Zu Gast bei Volle Kanne (ab ca. 10.05 Uhr)
Volle Kanne vom 6. Mai 2024
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 18.04.2024
Happy Birthday!
Jean Ziegler – Der Kämpfer gegen Hunger wird Neunzig
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal Update 10.04.2024
Premiere: „I dance, but my heart is crying“
Dokumentarfilm lässt Musik jüdischer Künstler aufleben
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.03.2024
Ein fulminantes Buch von Halldor Gudmundsson
Island: „Im Schatten des Vulkans“
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 28.03.2024
Lücken schließen – Neues Erinnerungsprojekt gestartet
Stolpertexte
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.03.2024
Das neue Buch von Katja Riemann
„Zeit der Zäune“: Am Schmerzpunkt der Welt
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 20.02.2024
Die Generation der Vielen
Bye, Bye Babyboomer?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Jounal 18.02.2024
20 Millionen Deutsche
Babyboomer – Generation der Vielen
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute.de 18.02.2024
Millionen Deutsche vor der Rente
Boomer: Generation Glücksfall oder Sündenbock?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal Update 12.02.2024
Gerettete Kunstwerke
Europäische Malerei – von Odessa nach Berlin
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 07.02.2024
Konsequenzen an der FU?
Jüdischer Student angegriffen
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Morgenmagazin 07.02.2024
Antisemitismus an Hochschulen
Angriff gegen einen jüdischen Studenten
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 05.02.2024
Tatort: Berlin Rosenthaler Platz
Entsetzen nach Angriff auf jüdischen Studenten
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 18.01.2024
Szenische Lesung
„Correctiv“-Enthüllungen um AfD am Berliner Ensemble
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal Update 17.01.2024
„Das Geheimtreffen von Potsdam“
„Correctiv“-Enthüllung als szenische Lesung
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.01.2024
Georgi Demidows beeindruckender Gulag-Roman
Gefängnisroman: Der Idiot
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 10.01.2024
Endlich! Nach über einem halben Jahrhundert: Georgi Demidow
„Fone Kwas oder: Der Idiot“ (Gulag-Roman)
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 23.12.2023
Die Kinder der Holocaust-Überlebenden
Retraumatisierung: Berliner Juden in Angst
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 17.12.2023
Tucholsky-Museum in Rheinsberg
Bedrohte Kultur in Zeiten der Sparpolitik
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 29.11.2023
Was geschieht 2024? Was kommt auf uns zu?
Rotstift für die Kultur
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Moma 28.11.2023
Solidaritätsabend für Israel
Konzert gegen das Schweigen
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 27.11.2023
Soli-Abend: „Gegen Antisemitismus“
Wie bricht man das Schweigen?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 16.11.2023
Der Superstar der Romantik wird 250
Caspar David Friedrich: „Ein Maler mit Herz“
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 14.11.2023
Der 7. Oktober und seine Folgen
Geisel-Angehörige: Hoffen auf ein Wunder
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF heute 11.11.2023
87 Jahre und kein bißchen leise
Ausstellung Wolf Biermann
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 10.11.2023
Neue ostdeutsche Welle – Hoyer, Rabe, Gneuß
DDR anders erzählen
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute 28.10.2023
Das Radio wird 100
Es begann in der Dachkammer
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 27.10.2023
Happy Birthday
100 Jahre Radio
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 26.10.2023
Vera Politkowskaja und Jelena Kostjutschenko
Russland: Heimatliebe trotz Staatskritik
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 22.10.2023
Über 200 Geiseln in Hamas-Haft
Appell an Menschlichkeit: „Bring them home“
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 17.10.2023
Juden in Deutschland
Angst um Geiseln: Hilfe aus der Community
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 11.10.2023
„Im Namen der Deutschen“ – neue Studie, neues Buch
„NS-Vergangenheit Bundespräsidialamt“
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 05.10.2023
Wortkarg, aber auf dem Punkt
Literaturnobelpreis 2023 für Jon Fosse
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 18.09.2023
Wer mag Regen? Wer Schirach?
Der neue Schirach
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 11.09.2023
Jetzt auch als Schauspieler
Ferdinand von Schirach „Regen“
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 06.09.2023
„Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis“
Stimmen von Frauen im Krieg
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.08.2023
Facing North Korea
Kunst als Waffe – Sun Mu-Ausstellung in Berlin
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.08.2023
Verloren, verdrängt, vergessen
Das Schicksal der Wolfskinder
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 17.08.2023
Maueropfer von 1962
Eine Straße für Peter Fechter?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute.de 01.08.2023
Trockenheit und Wassermangel
Liegt Berlin bald nicht mehr an der Spree?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 29.07.2023
Vor 50 Jahren: Love and Peace auf dem Alex
Ost-Berlin: Weltfestspiele 1973
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 21.07.2023
Sommerloch–Geschichten – Der Löw´ist los
Suche nach Raubtier beendet
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 06.07.2023
Biermann museumsreif (XL-Fassung)
Ein deutscher Rebell – Wolf Biermann
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 05.07.2023
Wolf Biermann ist museumsreif
Biermann-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 22.06.2023
Was ist im Osten los?
AfD-Aufstieg als Weckruf
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 21.06.2023
AfD-Umfragehoch. Warum?
Abgehängt? Politikverdrossenheit im Osten
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 16.06.2023
Volksaufstand oder faschistischer Putschversuch?
Mit Stefan Wolle (ca. 12 Minuten)
Der Aufstand vom 17. Juni 1953
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 15.06.2023
17. Juni 1953
Vor 70 Jahren: Volksaufstand in der DDR
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 25.04.2023
Vor vierzig Jahren: Von der Weltsensation zur Riesen-Blamage
Hitler-Tagebücher kommen ins Bundesarchiv
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Morgenmagazin 19.04.2023
Benjamin Stuckrad-Barre über Macht, MeToo und toxische Beziehungen
Noch wach? – Wirbel um neuen Roman
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Mittagsmagazin 14.04.23
Die Welt des Mathias Döpfner II
Empörung um interne Springer-Kommunikation
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute 13.04.2023
Die Welt des Mathias Döpfner
Brisante Chats von Springer-Chef aufgetaucht
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 12.04.2023
Der Fall Domaschk
Tod in Stasi-Haft
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 10.04.2023
„Wir haben keine Lösung. Wir haben Lieder.“
Element of Crime-Album – „Morgens um Vier“
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 02.04.2023
Happy Birthday – ein Grund zum Feiern?
60 Jahre: Das ZDF in der Kritik
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 27.02.2023
90 Jahre Reichstagsbrand
Wer steckte hinter dem Reichstagsbrand 1933?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 27.02.2023
Reichstagsbrand 1933
Neues zum Reichstagsbrand vor 90 Jahren
///////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal update 24.02.2023
Mit Panzern Frieden schaffen?
Botschaft vor der Russischen Botschaft
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Mittagsmagazin 15.02.2023
Bau auf, bau auf – Neues im Osten
Zukunftszentrum für Deutsche Einheit
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 10.02.23
Über „destruktive Macht“
Schwarzbuch Putin
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 02.02.2023
80 Jahre nach Stalingrad
Die Weltkriegsrhetorik russischer Propaganda
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 23.01.2023
Zwischen Welten – Der neue Roman von Juli Zeh und Simon Urban
Zwei Welten im Gespräch
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 06.01.2023
Hier reden die Menschen aus Berlin-Neukölln
Neukölln nach der Silvesternacht
////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute journal 21.12.2022
Suppenküche Pankow – eine Berliner Institution
Wenn die Glocke läutet: Essensausgabe
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 16.12.2022
Ein neuer Dokumentarfilm über unbeugsame Frauen
Deutschlandpremiere „Oh, Sister“
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.12.2022
Pay what you can – Erst erleben, dann zahlen
Neue Theater-Eintrittsmodelle
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 09.12.2022
Urgestein des ZDF – ein Nachruf
ZDF-Moderator Ruprecht Eser gestorben
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 22.11.2022
Homes.S, das Vermächtnis des Ausnahmepianisten
Neue Musik von Esbjörn Svensson
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Morgenmagazin 15.11.2022
Sie waren jung, wild und romantisch
Die Rebellen von Jena
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 14.11.2022
Andrea Wulfs neues Buch: „Fabelhafte Rebellen“
Die Rebellen von Jena
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute/Heute Journal 09.11.2022
Ein unabhängiger, unbequemer und unbeugsamer Mensch
Nachruf auf Werner Schulz
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 30.10.22
Mit Kartoffelbrei gegen Monet. Obszön oder sinnvoll?
Weltschätze oder Weltrettung?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 16.10.2022
Vor der Frankfurter Buchmesse 2022 – Friedenspreise für Kriegstagebücher
Alternativen zum Krieg?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 05.10.2022
„Ich war 19“ – „Berlin – Ecke Schönhauser“ – „Solo-Sunny“ – „Sommer vorm Balkon“
Wolfgang Kohlhaase tot
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 05.10.2022
Einer, der Menschen zum Leuchten bringen konnte
Nachruf Wolfgang Kohlhaase
////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 26.09.2022
„Geschichten aus der Heimat“
Dmitry Glukhovsky und Russland
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 25.09.2022
„Geschichten aus der Heimat“
Kremlkritischer Autor Glukhovsky zum Krieg
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Morgenmagazin 21.09.2022
ME/CFS – die unerforschte Krankheit
Hilfe beim chronischen Fatigue-Syndrom
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.09.2022
Über RBB, NDR und die Krise der öffentlich-rechtlichen Anstalten
Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 31.08.2022
Über einen tragischen Helden
Berlin und Michail Gorbatschow
//////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.08.2022
Mitten unter uns: Menschen am Limit
Mission Armutsbekämpfung
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal Update 22.08.2022
Zerschossenes Auto auf dem Kudamm
Kunst, Krieg und Kontroverse
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 15.08.2022
Über Boni, Dienstwagen und Beraterverträge
RBB: Schlesinger wurde abberufen
////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.08.2022
Der Osten des Westens
Zonenrandgebiet
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute 08.08.2022
Reaktionen zum Fall Schlesinger
RBB-Intendantin zurückgetreten
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 04.08.2022
Sprengplatz in Flammen
Feuer und Explosionen im Berliner Grunewald
///////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Mittagsmagazin 23.05.2022
Ein Basketballclub geht neue Wege
Alba Berlin: Initiative „Sport vernetzt“
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 18.05.2022
Das neue „Kleine Grosz-Museum“ in Berlin
Chronist und Meistermaler von Babylon-Berlin
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Morgenmagazin 05.05.2022
Groszartiges Comeback eines verstoßenen Berliner Malers
Tankstelle wird Grosz-Museum
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.04.2022
Überleben in Theresienstadt
„Ich war nie nur eine KZ-Nummer“
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute.de 26.04.2022
Aufwühlende Botschaften entdeckt
Die geheimen SS-Zellen von Theresienstadt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 13.04.2022
Letzte Lebenszeichen im ehemaligen SS-Ghetto-Gefängnis entdeckt
Graffitis in Theresienstadt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute.de 16.02.2022
Berlinale Premiere – Doku über die AfD
Kontroverse über „Eine deutsche Partei“
Mit Interview mit Regisseur Simon Brückner
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 02.02.2022
Hans-Erdmann Schönbeck: Ein Überlebender (Jahrgang 1922) erinnert sich
Von Tod und Elend – die Schlacht um Stalingrad
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 10.10.2021
Pleiten, Pech und Pannen
Typisch Berlin?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 14.09.2021
Einzige Musikschule in Kabul in Gefahr
Von der Bühne ins Versteck: Musikerinnen in Afghanistan
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 05.09.2021
Der neue Sven Regener Roman Glitterschnitter
Herr Lehmann, mal wieder
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 19.08.2021
Kabul – City in the Wind
Afghanische Filmemacher in Gefahr
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.08.2021
Das deutsche Monstrum – eine ewige Wunde?
Wolf Biermann zum 60. Jahrestag des Mauerbaus
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 01.08.2021
Große Pläne für den Bug
Rügen: Mega-Projekt im Paradies
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 26.07.2021
Eine tradtionsreiche Straße wird umbenannt
Mohrenstraße in Berlin – Widerspruch kostet
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.07.2021
Die Tochter des Opfers, die Enkelin des Attentäters
Hitler-Attentat war richtig und wichtig
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal:update 13.07.2021
Wolf Biermann – Ein Rebell wird Staatsdichter
Liedermacher spendet Privatarchiv
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 21.06.2021
Von der Dorflinde in Kartitz zur Weltzeituhr am Alex
Erinnern an Flucht und Vertreibung
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 16.06.2021
Das neue Belarus-Buch von Olga Shparaga
Die Revolution hat ein weibliches Gesicht
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 19.05.2021
Wolfgang Borchert wird 100 – ein Grund zum Wiederentdecken!
Draußen und allein
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 09.05.2021
Sophie Scholl wird 100 – ein Grund zum Feiern!
Vom Hitlermädchen zur Heldin des Widerstands
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 27.04.2021
Verständnis der Kanzlerin für Frust – Reicht das?
Berliner Kultur auf Sparflamme
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal:update 23.04.2021
Alle noch ganz dicht? Über Protestvideos in der Pandemie
Kritik an Protest-Videos
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 07.04.2021
Berlin April 1945. Brot oder Leben?
Todesurteile nach „Brotaufstand“ von Rahnsdorf
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 07.04.2021
Warum Margarete Elchlepp und Max Hilliges sterben mussten
Der Brotaufstand in Berlin-Rahnsdorf
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 22.03.2021
Berlin testet Romeo und Julia mit Publikum XXL
Testkonzert Philharmonie
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.03.2021
Romeo und Julia im Testkonzert in der Philharmonie
Kultur-Neustart Berlin
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute.de 20.03.2021
Pilotprojekt Neustart Kultur
Wieder ein wenig Licht in der Großstadt
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 19.03.21
Berlin probiert Kultur mit Schnelltests
Endlich wieder Theater: Testweise
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute.de 12.03.2021
Ein Jahr Corona-Tagebuch des Fotografen Daniel Biskup
Lächeln, aber bitte mit Abstand
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute.de 08.03.2021
US-Vize Kamala Harris – „Der Wahrheit verpflichtet“
„Uns eint mehr als uns trennt“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 12.02.2021
Erich Fried & Michael Kühnen: „Eine deutsche Freundschaft“
Der Dichter und der Neonazi
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 09.02.2021
Knapp ein Jahr staatlich verordneter Stillstand
Kultur sendet SOS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 01.02.2021
Momentaufnahmen aus einem veränderten Land
Foto-Tagebuch der Corona-Krise
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute 25.01.2021
Schäuble: „Das Paradies hat eine neue Adresse“
Berlin: Staatsbibliothek wiedereröffnet
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Morgenmagazin 25.01.2021
Paradies für Bücher
Wiedereröffnung Staatsbliothek
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 18.01.2021
Ein Grund zum Feiern? Ein Grund zum Nachdenken
Vor 150 Jahren: Die Reichsgründung
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 04.01.2021
Friedrich Dürrenmatt: „Die Welt ist eine Irrenanstalt“
100 Jahre Provokateur Dürrenmatt
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute.de 02.01.2021
Als Abstand ein Fremdwort war – Berlins wilde Neunziger
Love-Parade – „Für fünf Minuten ein Star“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 17.12.2020
Streitbar oder umstritten? – ein Porträt
Monika Maron
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal:update 10.12.2020
Alle Jahre wieder – Licht in die Dunkelheit
Chanukka 2020 in Berlin
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute.de 29.11.2020
Joe Bidens Autografie – „Versprich es mir“
Joe Bidens Versprechen
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal up:date 27.11.2020
Joy Denalane träumt von einer besseren Welt
„Soul is the truth“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 13.11.2020
Was nun, armer Poet, arme Poetin?
Milliarden für die Kultur – wer bekommt wann und wie viel?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute.de 08.11.2020
Joy Denalane bei Motown
„Soul is the truth“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 16.10.20
Belarus vor dem Ultimatum – Verhaftungen gehen weiter
Olga Spharaga in Arrest
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Morgenmagazin 09.10.2020
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Philosophen
Wie Corona die Gesellschaft prägt
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF 17.09.2020
DDR-Grenzer erzählen – ZDF Doku 45 Minuten
„Am Todesstreifen“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute.de 01.09.2020
„Antikriegstag“ 1. September
Vom Glück, 75 Jahre in Frieden zu leben
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 30.08.2020
Hermlins Impfstoff in Zeiten der Pandemie
Mit Swing gegen Corona
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 18.08.2020
Neustart am Jüdischen Museum Berlin
Jüdische Geschichte und Gegenwart
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Dokumentation 2020 45 Minuten
Am Todesstreifen – DDR-Grenzer erzählen
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 13.08.2020
Ex-Leutnant der Grenztruppen: „Ich hätte geschossen“
Ein Grenzschützer erinnert sich
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.07.2020
Ein Märchenschloss mitten in Brandenburg
Ein Wunder für Gentzrode?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 17.07.2020
75 Jahre Potsdamer Konferenz
Joy Hunter – Churchills Sekretärin
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Phoenix 12.07.2020
Die Weltzeituhr am Berliner Alexanderplatz
So tickt der Alex
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Moma 30.06.2020
Inselkind Susanne Matthiessen über die „Wilden Siebziger“
Die Goldenen Jahre auf Sylt
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 22.06.2020
In Erinnerung an Jürgen Holtz (1932-2020)
Jürgen Holtz in „Galileo Galilei“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 21.06.2020
Die Welt des Dioramen-Malers Uwe Thürnau
Natur als Vorbild
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 20.05.20
Hannah Arendt über die „Banalität des Bösen“ (XL-Version)
Hannah Arendt-Ausstellung im DHM
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.05.2020
„Denken ohne Geländer“ – wie geht das?
Hannah Arendt-Ausstellung in Berlin
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 08.05.2020
Als die Russen kamen – Berlin im Mai 1945
Zeitzeugen erzählen ihr Kriegsende
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDFHeute 01.05.2020
75 Jahre Kriegsende in Berlin – Zeitzeugen erinnern sich
Grießbrei von den Russen
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3-Sat Kulturzeit 02.04.2020
April 1945 – Als die Stadt Nordhausen in Thüringen unterging
Erinnern an den Bombenkrieg im Harz
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 02.03.2020
Marc-Uwe Kling: Kreuzberger Kleinkünstler macht großes Kino
Kling und das Känguru
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF heuteXpress 24.02.20
Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun über den Dialog in Gesellschaft und Politik
„Die Kunst des Miteinander-Redens“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 13.02.2020
Dresden, Nordhausen, Wesel uva.
Bombenkrieg – 75 Jahre danach
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF 04.10.2019
Berlin-Alexanderplatz
So tickt der Alex – 50 Jahre Berliner Weltzeituhr
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 18.07.2019
Sophie von Bechtolsheim – die Stauffenberg-Enkelin
„Es war eine Gewissensentscheidung“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3-Sat Kulturzeit 03.07.2019
Sophie von Bechtolsheim „Mein Großvater war kein Attentäter“
Stauffenberg – Vorbild oder Verräter?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3-Sat Kulturzeit 24.06.2019
Geheime Botschaften aus dem Ghetto – XL-Version
Zeichnungen aus Theresienstadt
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 16.06.2019
Spurensuche in der Mansarde L237 in Theresienstadt
Vier Jungs aus der Dachkammer
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Morgenmagazin 04.06.2019
Mehr als Öl, Lachs und Krimis – Gastland Norwegen auf der Frankfurter Buchmesse
Besuch bei Norwegens Autoren
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 29.05.2019
„Ich war der letzte Bürger der DDR“
Roberto – Honeckers Enkel
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Norwegisches Fernsehen NRK-TV 23.05.2019
Deutsche Journalisten in Norwegen (auf norwegisch/englisch)
Lars Mytting – Glocken von Ringebo
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 11.04.2019
Ian Kershaw erklärt Europa seit 1950
Achterbahn
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 09.04.2019
Europa? Was war, was ist, was wird?
Kershaws „Achterbahn“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 02.04.2019
* / _ ?! Neusprech! – Akt der Fairness oder Unfug?
Richtig Gendern
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.03.2019
Gastland auf der Leipziger Buchmesse 2019
Überraschendes Tschechien
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 09.03.2019
Next Generation am Gorki-Theater
Witze über den Holocaust. Geht das?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 11.02.2019
Berlinale 2019 – ein Film, eine Lehrstunde
„Das Geheimarchiv in Warschau“
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 10.02.2019
„Die Kunst ist die Tochter der Freiheit“
Kulturkampf: Streit ums Theater
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 21.01.2019
Castorf: Sechs Stunden Brecht mit Holtz
Galileo Galiei am BE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 14.01.2019
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
100 Jahre Revolution
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.12.2018
„Versöhung ist möglich“
Amos Oz – Patriot und Friedensaktivist
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 15.12.2018
Leander Haußmann inszeniert an der Volksbühne
Ein Hoch auf die Staatssicherheit!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 21.11.2018
60 Jahre alt und und kein bisschen angestaubt – Max Frisch am Berliner Jugendtheater Parkaue
Biedermann und Brandstifter
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 02.11.2018
Sophie Hunger auf großer Tour
Schweizer Sängerin erobert Berlin
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 30.10.2018
Vor hundert Jahren: Kaiser Wilhelm II auf der Flucht
Ende von Preußens Glanz und Gloria
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 25.10.2018
Auktion für das neue Exilmuseum
Kunstsammlung unter dem Hammer
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.10.2018
Die alternative Antwort zum Desaster mit dem offiziellen Nobelpreiskomitee
Literaturpreis für Maryse Condé
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.10.2018
Gastland Georgien
Was wissen Sie über Georgien?
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 10.10.2018
„I´m on the same page“
Menschenrechte auf Frankfurter Buchmesse
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 09.10.2018
Hohenschönhausen statt Kreuzberg
Neuer Kunst Hotspot Hohenschönhausen
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 29.09.2018
Wie wollen wir in zehn Jahren leben? Let them eat money.
Welche Zukunft? Projekt am Deutschen Theater
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 26.09.2018
Top oder flop? Glücksfall oder Reinfall?
Bewegte Zeiten – Die Bilanz der 68er
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Dokumentation 26.09.2018
Eine Generation – vier Wege
Die 68er – Wir waren die Zukunft
45 Minuten
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF-Frontal 21 11.09.2018
„Warum ich Nazi wurde“
Historisches Preisausschreiben 1934
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 22.08.18
Andreas Dresens Antwort auf „Das Leben der andereren“
Gundermann
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 13.08.2018
Gerhard Gundi Gundermann
Der rockende Baggerfahrer
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 01.08.2018
Eine Jahrhundertgeschichte – Ein Leben wie ein langer Kinofilm
Filmlegende Atze Brauner wird 100
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 19.07.18
XXL-Fassung über den „Boss“ in Ost-Berlin
30 Jahre Bruce Springsteen in Berlin
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 18.07.18
Born in the USA – ein Hauch von Woodstock in Weißensee
1988: Bruce Springsteen in der DDR
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 10.07.18
Freilassung der Witwe des Friedensnobelpreisträgers
Liu Xia: Nach acht Jahren in Freiheit
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Morgenmagazin 11.04.18
Gretchen Dutschke und die drei Schüsse
Vor 50 Jahren: Attentat auf Rudi Dutschke
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 09.04.18
50. Jahrestag Dutschke-Attentat
Drei Schüsse auf Rudi Dutschke
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Hallo Deutschland 09.04.18
Was waren die 68er?
50 Jahrestag Dutschke-Attentat
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 16.03.18
Rumänien heute
Unsere Utopie ist Normalität
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 14.03.18
Die Sorgen einer wohlhabenden Stadt – was tun?
Integration in Heilbronn
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF 14.03.18
„Diamanten im Müll“ – Rumänien auf der Leipziger Buchmesse
Gastland Rumänien
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF 04.03.2018
Große Koalition und das Land: Vor Ort in Witzin und Heilbronn
Wenn nicht hier, wo dann
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 18.02.2018
Vienam-Kongress 1968
Der Traum von der Revolution
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 22.12.17
Was tun, wenn Jude wieder ein Schimpfwort wird
Berliner Initiativen gegen Antisemitsmus
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 16.12.2017
Kreuzberg im Wandel
Hotel scheucht Kreuzberg auf
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.11.2017
Neues aus dem Berliner Untergrund
Artist Homes: Kunst im Nazi-Bunker
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 02.11.2017
Was ist aus dem „Nazi-Schatz“ geworden?
Gurlitt-Schau: Kunst mit Schatten
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 30.10.2017
„Wir sind alle Bettler nur“
Bilanz Luther-Jahr 2017
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 17.10.2017
Dichtertreffen in Waischenfeld
50 Jahre „Gruppe 47“
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 14.10.2017
Mythos Gruppe 47 – was ist geblieben?
Klassentreffen der Literaten
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Morgenmagazin 14.09.2017
Was gibt es Neues in der Kunst?
Art Week Berlin 2017
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 10.09.2017
Chris Dercon will das Theater verändern
Neustart an der Volksbühne
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 08.09.2017
Über die Stadt der Zukunft
60 Jahre Hansa-Viertel
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute.de 03.09.2017
Staatsoper Berlin, Elbphilharmonie oder Kölner Oper
Baustelle Bühne: Warum Sanierungen so teuer sind
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 14.08.2017
Der Vietnamkrieg aus einer neuen Sicht
Der Sympathisant
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 18.07.2017
Wer wird Erich Mielkes Nachmieter?
Die Zukunft der Stasi-Zentrale
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 17.07.2017
Wie heiß wird der Sommer 2100?
Klimawandel in Berlin
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 10.07.2017
„Erinnern ist meine Verpflichtung“
Peter Härtling Nachruf
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 29.06.17
Sonderausstellung im Martin Gropius-Bau in Berlin
Kafka – der ganze Prozess
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 24.06.2017
Was bewegt junge Menschen in Parteien ihr Glück zu versuchen?
Jugend macht Politik
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute+ 21.06.2017
Can Dündar über das türkisches Gefängnis Silivri und seinen Kollegen Deniz Yücel
Freiheit ist ein seltsames Ding
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.06.2017
Youn Sun Nah mit magischen Momenten
Stimmwunder aus Südkorea
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 13.06.2017
Streit um das neue Urheberrechtsgesetz
Verleger fürchten Verluste
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 25.05.2017
Obama, Merkel und die Jugend
Obama beim Kirchentag
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 24.05.2017
Kirchentag, Sicherheit und AfD
Hohe Sicherheit für Kirchentag
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.05.2017
Wie viel Wehrmacht steckt in der Bundeswehr?
Traditionspflege in der Bundeswehr
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kulturzeit 11.05.2017
Schlöndorffs persönlichster Film – der Beitrag in XXL-Fassung
Rückkehr nach Montauk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 06.05.2017
Max Frisch, Volker Schlöndorff und die ewige Sehnsucht
Rückkehr nach Montauk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 11.04.2017
Wer ist dieser Martin Luther?
Der Luther-Effekt
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 06.04.2017
Das Attentat von Karlsruhe vom 07.04.1977 – wer waren die Täter?
Bubacks Ermordung bleibt ein Rätsel
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDFinfo 02.04.2017 – 20.15 Uhr
Eine Recherche 40 Jahre nach dem Attentat von Karlsruhe – 45 Minuten
Wer erschoss Siegfried Buback?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Morgenmagazin 31.03.2017
Ein Fall zwischen Staatsräson und historischer Wahrheit
Wer erschoss Siegfried Buback?
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 04.03.2017
Berlins neues Wohnzimmer für gute Musik
Eröffnung Pierre Boulez-Saal
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 03.03.2017
Ein europäisches Jazz-Talent am Bass
Kinga Glyk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 02.03.2017
Wo ist der Turm der blauen Pferde?
Franz Marc: Vermisst
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.02.2017
Ist Frank-Walter Steinmeier der richtige Mann?
Wahl des Bundespräsidenten
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kulturzeit, 12.01.2017
Kann Andrej Holm im Amt bleiben? Eine Debatte vom Prenzlauer Berg
Staatssekretär Holm
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal, 12.01.2017
Stasi-Offizierschüler, Gentrifizierungsgegner, Staatssekretär
Der Fall Holm
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal, 21.12.2016
Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt
Berlin trotzt dem Terror
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kulturzeit, 15.12.2016
„Lasst uns reden“ – Künstler, Positionen und Populismus
Theaterstreit über Umgang mit AfD
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 13.12.2016
Erfinder, Unternehmer, Familienmensch
Werner von Siemens zum 200. Geburtstag
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.12.2016
Kaiser Willhelm oder „Einheitswippe“
Der Streit um das Berliner Freiheits- und Einheitsdenkmal
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
heute.de 15.11.2016
Wolf Biermann -Warte nicht auf bessere Zeiten
„80 – und kein bisschen leise“
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 28.10.2016
Vom Waisenkind in Senegal zum Bundestagsabgeordneten
Die Geschichte des Karamba Diaby
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 21.10.2016
Der vergessene Journalist Konrad Heiden
Hitlers erster Feind
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 03.09.2016
Eine deutsche Familie nimmt einen Syrer auf – ein Tagebuch
Unter einem Dach
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute+ 16.08.2016
Erste Fahrt des Wünschewagens – ein Projekt des ASB
Unterwegs zum letzten Wunsch
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 01.08.2016
Oliver Hilmes Buch „Berlin 1936“
Hinter den Kulissen von Hitlers Olympia
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.07.2016
Stararchitekt Hans Kollhoff über die Berliner Piefigkeit
Bausünden in der Hauptstadt
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 20.07.2016
Sven Petry und Ludger Sauerborn über den Riss in der Gesellschaft
Wenn die AfD Familien spaltet
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 9. 06. 2016
Der Dokumentarfilm „Parchim International“
Große Vision für kleines Parchim – Chinese plant Dubai 2.0
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.05.2016
„Immer bunter“ – Die Einwanderung eine Erfolgsgeschichte?
Bunte Republik Deutschland – Einwanderung ins Museum
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.05.2016
Jan Böhmermann und die Folgen
Böhmermanns Comeback
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 04.03.2016
Die Affäre Schiwago
Schiwago – Das verbotene Buch
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 22.12.2015
Die Sorgen der „kleinen Leute“
Arm trotz Arbeit
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 14.12.2015
Zerbricht Europa?
Europa rückt nach rechts
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat-Kulturzeit 09.12.2015
Flüchtlinge als Museumsführer
Museums-Scouts
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 27.11.2015
Mit Kunst gegen Terror?
Schaubühne in Paris
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.11.2015
Kann Integration gelingen?
Neukölln vor großer Integrationsaufgabe
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 08.10.2015
Höchste Auszeichnung für eine beharrliche Frau
Literatur-Nobelpreis für Swetlana Alexijewitsch
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDFinfo. 27.09.2015
Zweite Heimat – wie die Einheit Deutschland veränderte. 45 Min.
Zweite Heimat
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit 10.09.2015
Stalin – eine Biographie von Oleg Chlewnjuk
Stalin – gestern und heute
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 20.08.2015
Egon Bahr – ein Lebensbild
Egon Bahr – Freiheit ist nicht alles, aber…
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kulturzeit 3Sat 31.07.2015
Deutsche Willkommenskultur 1945
Rupert Neudeck über Flüchtlinge damals und heute
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 28.07.2015
Einmal Flüchtling, immer Flüchtling?
Das Pack aus dem Osten
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 22.07.2015
Alt, arm, arbeitslos, ausländerfeindlich … aussichtlos?
Anklam und der Traum vom Fliegen
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 17.07.2015
Das große Comeback der Harper Lee
Harper Lee
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 15.07.2015
Das geplante Kulturgutschutzgesetz – Enteignung oder Schutz?
Kulturgutschutzgesetz
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 16.06.2015
Wer ist der neue Berliner Schlossherr Neil MacGregor?
Nationalpreis für MacGregor
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Heute Journal 12.06.2015
Nachrichten aus dem Ghetto – Ein Dachboden in Theresienstadt
Dachboden Theresienstadt
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3Sat Kulturzeit – 5. Mai 2015
Neil MacGregor neuer Gründungsintendant des Berliner Humboldt-Forums
Neil MacGregor
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 23.04.2015
„Chris Dercon: der neue Volksbühne-Chef“
Chris Dercon Volksbühne
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 18.04.2015
„Als die Soldaten kamen“ – Frauen als Kriegsbeute
Als die Soldaten kamen
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal 13.04.2015
Freunde und Gegner über Günter Grass
Stimmen zum Tod von Günter Grass
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Das Blaue Sofa 2015 19.03.2015
Best of Leipzig – u.a. mit dem letzten TV-Interview mit Günter Grass
Blaues Sofa 2015 ZDF 19.03.2015
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal. 27.02.2015
Jüdischer Alltag – Über Antisemitismus und die Kippa
Antisemitismus im Alltag ZDF Heute Journal 27.02.2015
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZDF Heute Journal. 21.02.2015
Der Untergang von Demmin
Selbstmord im Dritten Reich. ZDF Heute Journal. 2015
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Blick in den Rückspiegel
ZDFinfo. 9. November 2014. 45 Minuten
„Die Letzte Truppe und der Fall der Mauer“
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Helmut Schmidt – „Mehr Verantwortung“. 15 Minuten. 2010.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ARD. 1992. 30 Minuten.
„Die Glatzen von Spremberg“