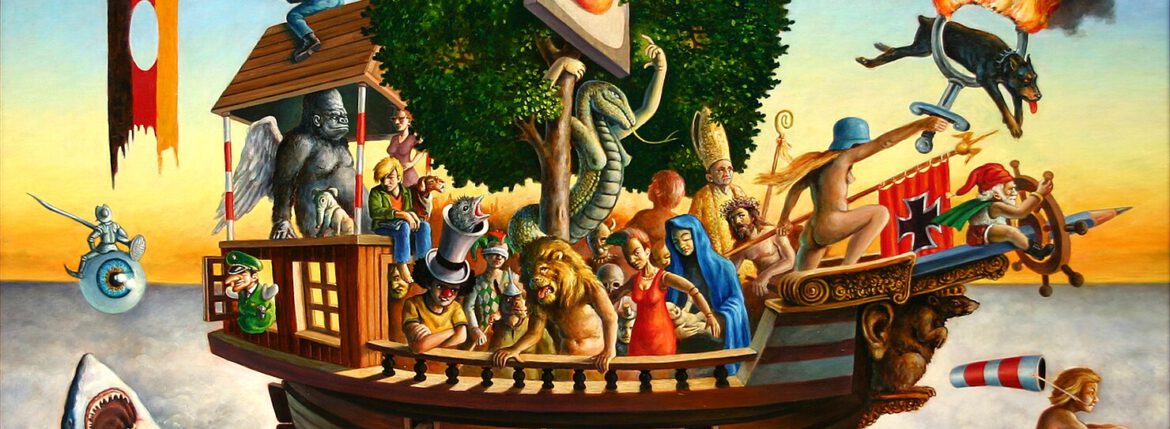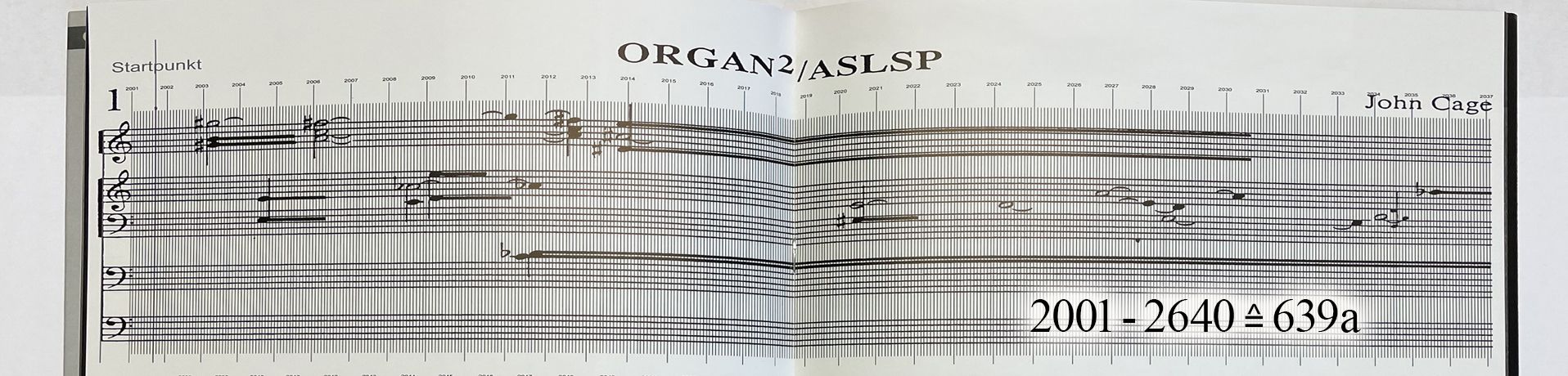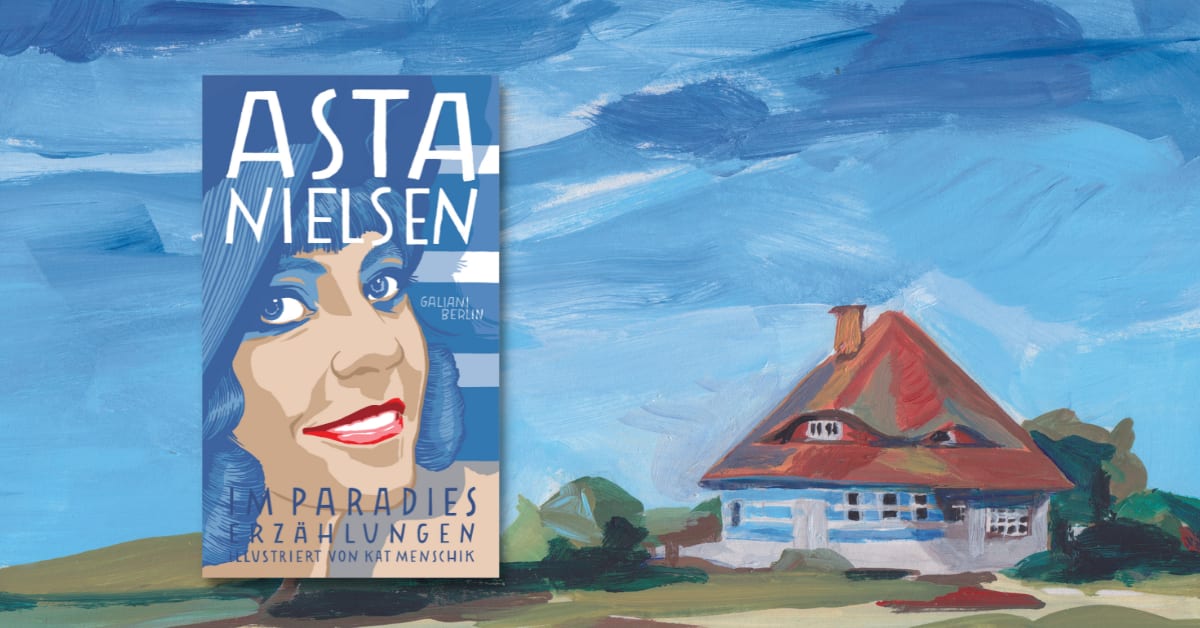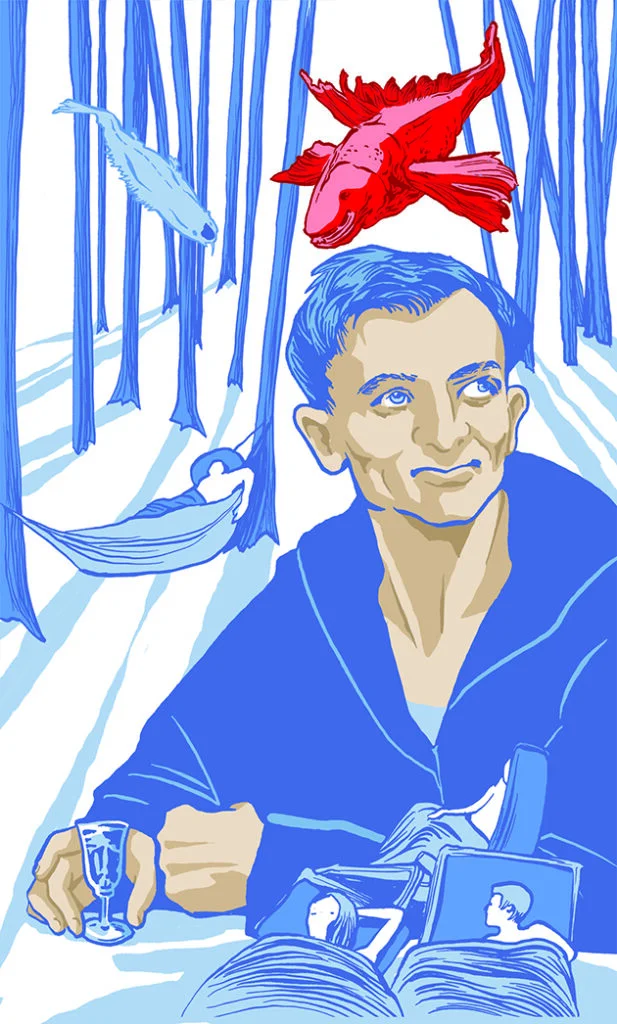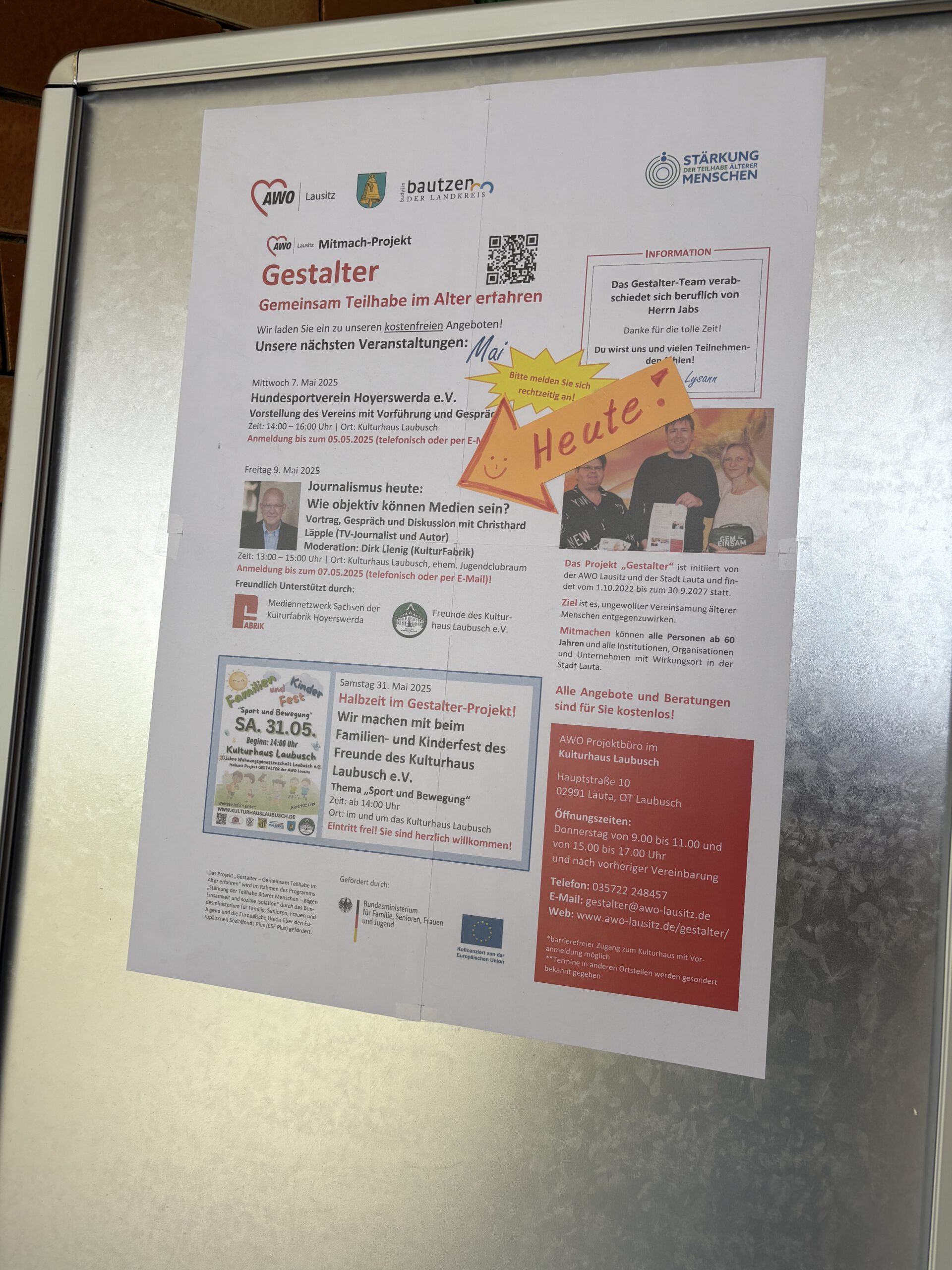Caligula und sein Pferd
Wahnsinn! Ein Tyrann und Narzisst! Wer Caligula googelt, stößt auf einen arroganten und exzentrischen Herrscher der Extraklasse. Sein richtiger Name: Gaius Iulius Caesar Germanicus. Der dritte römische Kaiser von 37 bis 41 nach Christus. Als Kind erhielt der kleine Gaius den Spitznamen „Caligula“. Das bedeutet „kleine Soldatenstiefel“ – eine Anspielung auf die Miniaturschuhe, die er während der Feldzüge seines Vaters Germanicus trug. War der Römer wirklich ein Monster? Ein Despot, der sein Pferd zum Konsul befördert? Ein Alleinherrscher, der die Rolle des Tyrannen neu definiert? Dessen Leitsatz lautet: „Sollen sie mich doch hassen, solange sie mich fürchten.“
Das „Soldatenstiefelchen“ wächst auf der Insel Capri auf. Dort verbringt Caligula (*31. August 12) sechs Jahre, bevor er nach Rom geht und bald zum Quästor ernannt wird. Mit 24 Jahren wird er zum Imperator, zum Kaiser von Rom, bestimmt. Anfangs ist er beim Volk äußert beliebt. Er senkt Steuern, veranstaltet Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe. Dieser Brot und Spiele-Mix kommt bestens an. Eine längere Krankheit wirft ihn im Alter von 25 zurück. Hinter seinem Rücken liefern sich im Hofstaat Senatoren Machtkämpfe um eine mögliche Nachfolge. In einer überlieferten Rede im Jahr 39 wirft Caligula Senatoren vor, ihn töten zu wollen. Caligula nimmt Rache. Er schaltet potenzielle Konkurrenten aus, darunter 36 Senatoren, seinen Stiefvater und den Chef der Prätorianer.
Caligula entwickelt sich zu einem der schlimmsten Kaiser Roms. Während seiner kurzen, knapp vierjährigen Herrschaft verlangt er, ihn als Gott zu verehren. Er soll mit seinen drei Schwestern Inzest begangen, sie verbannt und getötet haben. Dafür gibt es keinerlei Belege, nur Gerüchte. Aber diese halten sich zuverlässig bis heute. Sicher ist: Caligula macht sich immer mehr Feinde. Ab Frühjahr 40 wird seine Herrschaft im Römischen Reich lebensgefährlich. Gegner werden öffentlich ausgepeitscht. Köpfe rollen. Der starke Mann in Rom erzeugt kollektive Angst.
Eine der berühmtesten Geschichten sagt, Caligula habe geplant, sein Lieblingspferd Incitatus zum Konsul zu ernennen. Tatsächlich sollte sein Pferd einen eigenen Palast bekommen. Der Rest ist Legende. Wie auch immer: Caligula verspottet und verachtet den Adel, das damalige Establishment der Hauptstadt Rom. Er demütigt seine Gegner aufs Äußerste.
Caligulas Ende ist blutig. Am 24. Januar 41 verlässt der Herrscher das Theater in einem unterirdischen Tunnel. Dort wird er vom Offizier Cassius Chaerea, dem Chef seiner Leibgarde, erstochen. Die Herrschaft geht gewaltsam zu Ende. Entscheidend ist seine Leibgarde: die Prätorianer. Sie stehen für seinen Aufstieg und sein frühes Ende mit 28 Jahren.
Nun bleibt nur noch eine Frage: Ist die Geschichte vom selbstverliebten tyrannischen Herrscher ein Einzelfall und zweitausend Jahre alt, also verdammt lange her? Oder ist der Fall Caligula bis heute aktuell? Nicht nur in unzähligen Filmen und Romanen.