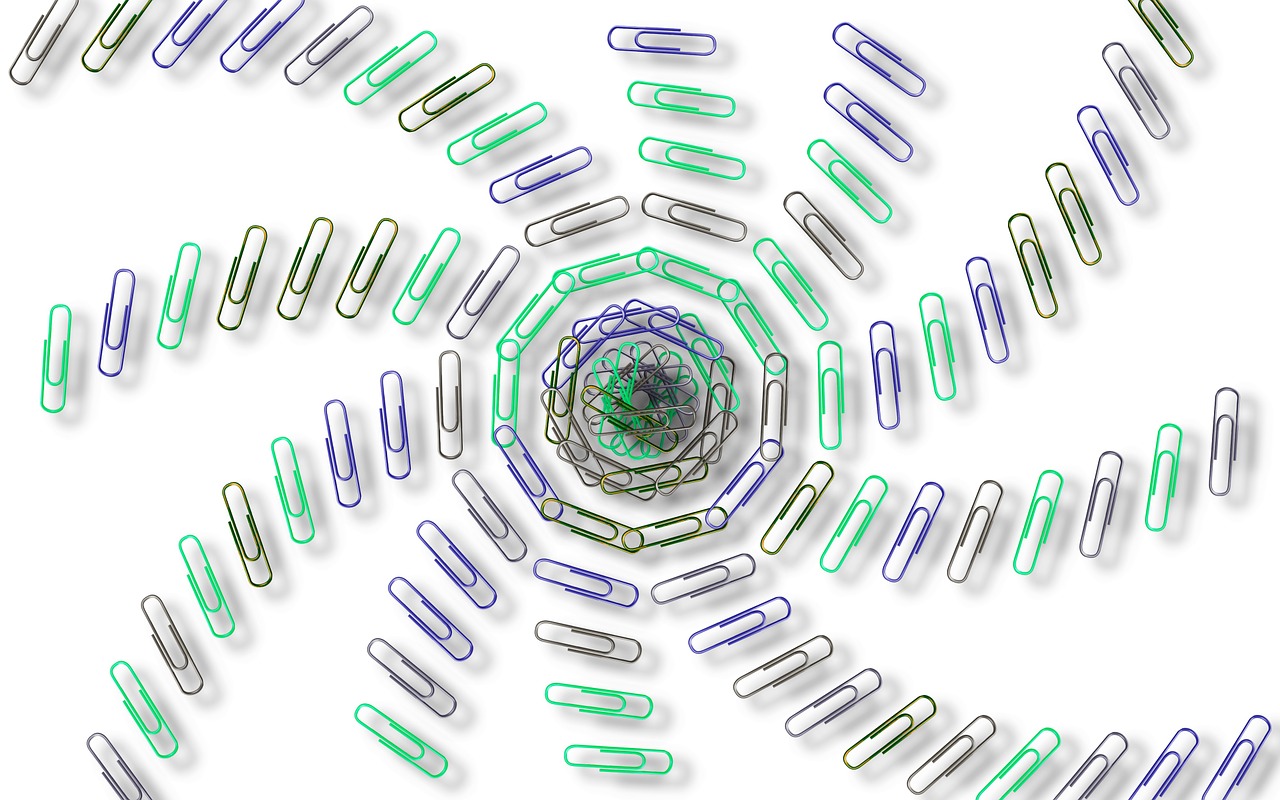Musik, die träumt
Er wird viel gespielt, ist verkannt und vergessen. Von jungen Musikern wird er jedoch begeistert wiederentdeckt: Gabriel Fauré. Ein französischer Komponist und Pianist. Spätromantiker vom Scheitel bis zur Sohle. Ein stiller, leiser Mann, der die sanfte Macht der Musik zelebrierte wie kein anderer. Er ist es wert, gespielt zu werden. Besonders Cantique, sein Lobgesang. Komponiert im Alter von 19 Jahren. Ein frühes Meisterwerk.
Der junge Student vertonte im Choral Cantique, auf Deutsch Lobgesang, eine 200 Jahre alte Textvorlage seines Landsmanns Jean Racine aus dem Jahre 1688. In dieser Hymne heißt es:
„Gieße aus auf uns das Feuer deiner machtvollen Gnade,
dass die ganze Hölle flieht vor dem Klang deiner Stimme.
Vertreibe diesen Schlummer einer trägen Seele,
der sie verleitet, deine Gebote zu vergessen.“
Das fünfminütige Loblied Cantique de Jean Racine wird gerne gemeinsam mit dem Requiem aufgeführt. Diese Werke verkörpern die magische Welt des Gabriel Faurés. (1845-1924) Seine Arbeiten sind intim und introvertiert, voller Anmut und Zauber. Er schuf eine vielfach verkannte Musik, die träumt. Die in sich ruht. Fauré ließ beim Komponieren die Sehnsucht von der Kette. Er war stets auf der Suche nach der verlorenen Zeit, genau wie sein Freund und Weggefährte Marcel Proust.
Mit Mitte fünfzig erkrankte Fauré und wurde schwerhörig. Er zog sich einsam zurück. Späte Anerkennung fand er erst im Tod. Das offizielle Paris spendierte 1924 ein pompöses Staatsbegräbnis. Sein Requiem gehört heute zu den häufig gespielten Werken, ob vor zwanzig Jahren bei der Trauerfeier für Francois Mitterand oder jüngst für die Opfer des LKW-Attentäters von Nizza.
Richtig entdeckt habe ich Cantique bei einem Studenten-Konzert der Berliner Universität der Künste. Junge Musiker verabschiedeten liebevoll ihren langjährigen Ausbilder Professor Ulrich Mahlert, der nach 95 Semestern Ausbildungszeit, wie er sich ausdrückte, in den Ruhestand ging. Die angehenden Musiker der größten Kunsthochschule Europas boten Beethovens Zweite, Robert Schumann, Felix Mendelssohn-Bartholdy und eben Fauré. Zum Wegschmelzen schön.
Mehr bei Jean-Michel Nectoux. Fauré. Seine Musik – sein Leben.