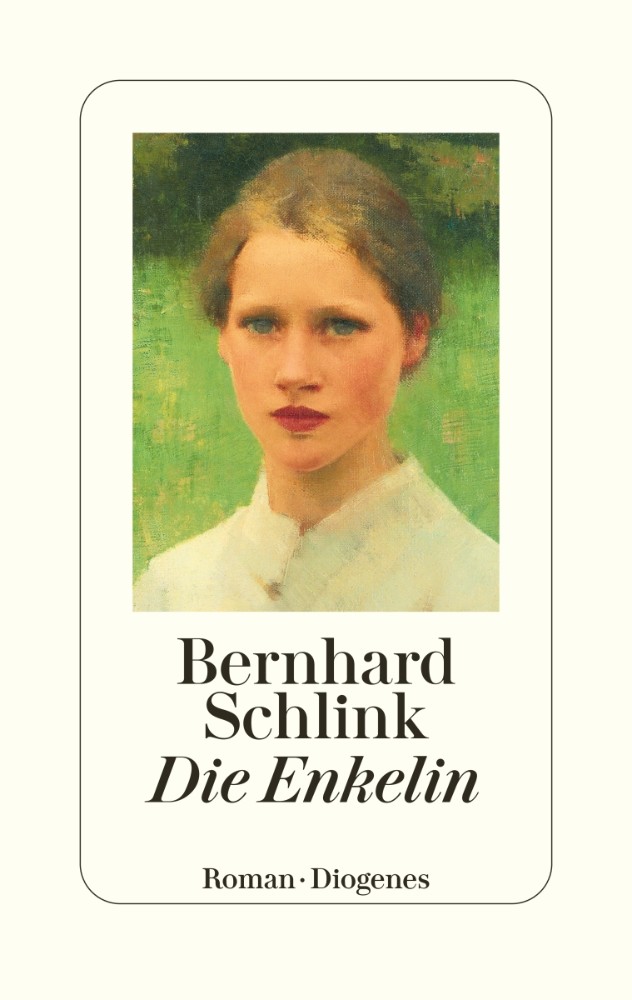Ein weites Feld
Buchhändler Kaspar hat eine Menge erreicht. Er hat seinen Traumjob, ist an der Welt interessiert und wähnt sich in der Regel auf der richtigen Seite. Nur mit seiner Frau, da läuft alles schief. Seine erste große Liebe stirbt früh, an Alkohol, Kummer und Verzweiflung. Die Frau, die der Mann aus dem rheinischen Westen im Osten kennengelernt hatte. Auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte, während eines FDJ-Treffens in den Sechzigern. Birgit, so heißt sie in Bernhard Schlinks neuem Buch „Die Enkelin“, ist strahlend, schlagfertig, einfach anders als die anderen. Nicht ideologisch borniert, sondern offen und neugierig. Er organisiert einen Fluchthelfer. Sie lässt die DDR zurück und ihre Tochter. Das verschweigt sie bis zu ihrem frühen Tode. Kaspar fällt aus allen Wolken. Er macht sich auf die Suche nach der unbekannten Tochter.
Die verschwiegene Svenja wächst in einer SED-treuen Familie auf. Auch sie erfährt hier nur ein kurzes Glück. Sie flüchtet wie ihre Mutter. Nicht in den Westen, sie begehrt im Osten auf. Nimmt im Nachwende-Land Drogen, surft in der S-Bahn und verprügelt Menschen, die anders aussehen oder nicht in ihr Weltbild passen. Sie heiratet einen rechten Siedler, zieht zu ihm aufs Land. Sie hält den Holocaust für ein „Wessi-Ding“ und feiert Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess als Märtyrer. Svenja rebelliert nicht aus Sattheit, auch nicht aus Langeweile oder weil es gerade cool ist, sondern weil sie es ernst meint. Die völkischen Eltern nennen ihre gemeinsame Tochter Sigrun. Auch sie ist ein heranwachsendes Mädchen, das stolz ist auf ihr Land und die Tagebücher der Anne Frank für eine Fälschung hält. Sigrun ist die Enkelin des Buchhändlers.
Bernhard Schlink gehört zu den Autoren, die bei ihren erzählerischen Abenteuern in die Abgründe des Alltages aufmerksam in den Rückspiegel schauen. Dort entdeckt er Beunruhigendes. Schon lange kümmert sich der Jurist und Bestseller-Autor („Der Vorleser“) um die Frage, was sich im rechten Spektrum zusammengebraut hat. Die Szene der völkischen Siedler ist ein großes, weites Feld. Es reicht von Impfgegnern über Verschwörungsanhänger bis zu einem militanten rechten Kern, der Gewaltmärsche organisiert und sich auf den Tag X vorbereitet. Die Völkischen haben ihre eigenen Foren und Codes. Bei ihnen heißt es Handtelefon statt Handy, Weltnetz statt Internet. Denn: „Des Volkes Seele lebt in seiner Sprache“. Bei aller Volkstümelei sind sie jedoch vernetzt von Bautzen bis Boston. Von Bologna bis Budapest.
Der Großvater kämpft um die Seele der verlorenen Enkelin. Er will Sigrun zurückgewinnen. Er holt sie vom Land, zeigt ihr seine Buchhändler-Welt. Er setzt auf Bach, Brahms und Beethoven. „Du hast ein Ohr für Musik, Sigrun, und Hände fürs Klavier. Du hast etwas Besonderes, etwas Kostbares – lass die Politik raus.“ Mach was aus deinem Leben, fleht der Mann des Wortes. Das Klavierspiel als Ausstieg aus der Welt der völkischen Siedler mit ihrem Hass und ihren Hakenkreuzen, gepierct am Ohr, getragen bei Gemeinschaftsfeiern unterm wallenden Haar? Es hat etwas Berührendes, wie Schlink seinen Buchhändler auf die Ideale von Goethe und Schiller setzen lässt. Die Aufgabe der Deutschen sei nicht die Entfaltung von Macht und Zerstörung, sondern die Erneuerung und Weiterentwicklung von Kultur. So will er die Enkelin aus dem Reich der rechten Verführer entreißen. Mit Bach und Rilke. Ob das gelingt? Es lohnt sich, dem versierten Erzähler Bernhard Schlink bis zur letzten Zeile zu folgen.