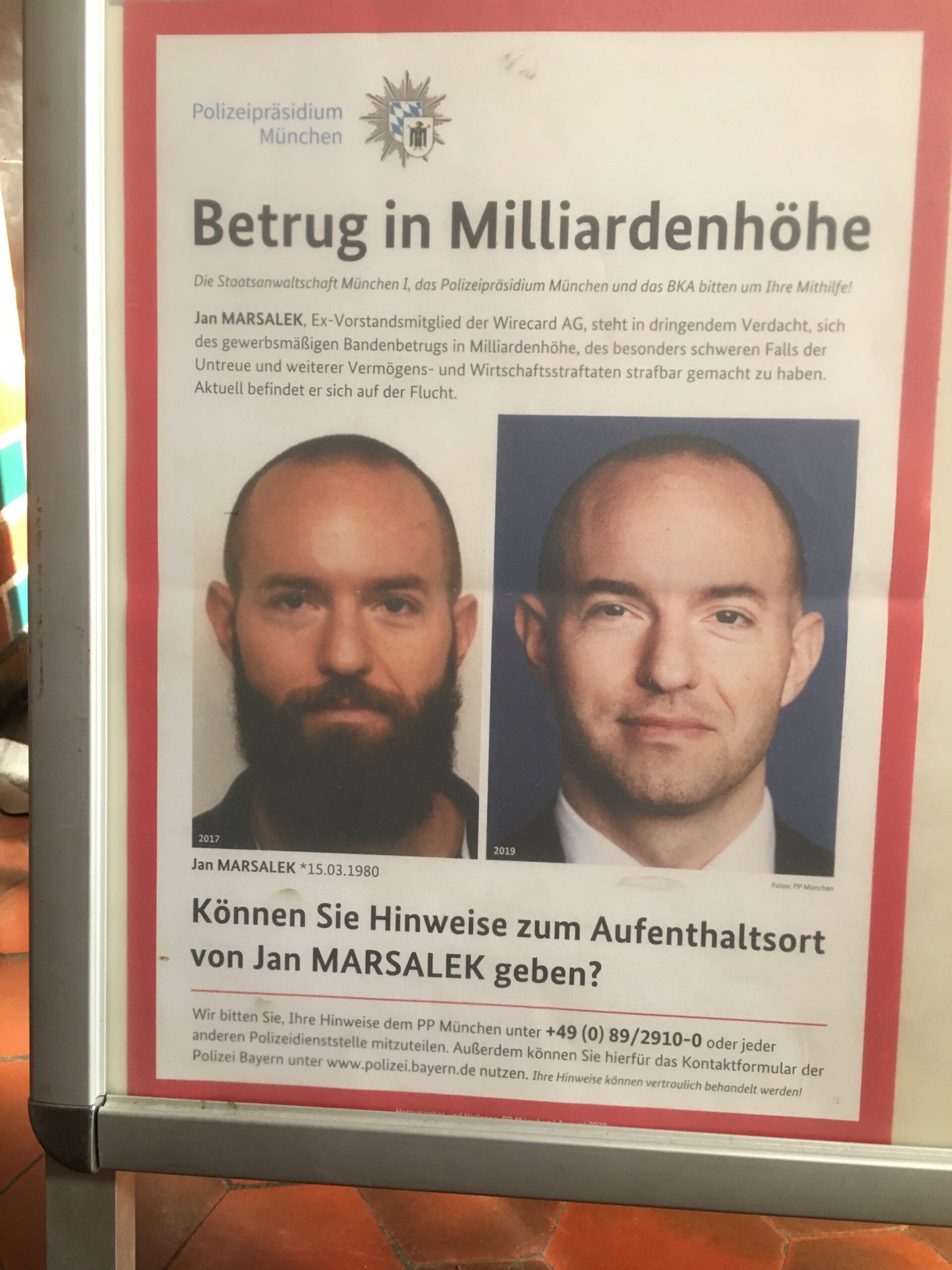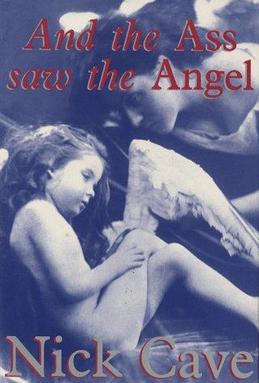„Mein Herz ist ein Automat aus Blech“
Eine junge Frau wartet auf den Zug. Am Bahnsteig lockt sie ein Snackautomat. Sie sucht nach Münzen. Plötzlich springt ihr Zwillingsbruder vor den einfahrenden Zug. Das Einstiegsszenario für Olivia Wenzels Debut 1000 Serpentinen Angst. Mit Vollgas und Wumms legt sich die Autorin in die Kurven, rast um die Welt. Von ihrer Heimat Thüringen über Berlin, Vietnam bis nach New York. Ihr Road Movie erzählt von der wilden Reise einer jungen Ostdeutschen auf der Suche nach dem kleinen und großen Glück. „Ich komme aus einer Familie, in der die Idee, sich so weit wie möglich von sich selbst zu entfernen, übertrieben romantisiert wurde“.
Die junge Glücksucherin ist Kind einer DDR-Punkerin und eines Angolaners. Die Mutter wird in den Achtzigern nach der Geburt ihrer Zwillinge verhaftet. Warum? Um „ihre Bürger paranoid zu machen. Wasserzelle, Einzelhaft, Gruppenisolierung im lichtlosen Keller, langes Stehen bei Schnee im Hof, gezielte Mangelernährung … wegen ein paar Flugblättern. Oder wegen einem Punkkonzert in einer Kirche“.

Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2020. Nicht in die Endrunde geschafft. Egal. Das Buch hat Wumms.
Der Vater verkrümelt sich, meldet sich maximal ein bis zweimal im Jahr. Als Kind wünscht sich die Tochter nichts sehnlicher als eine Creme, die „mich über Nacht weiß machen würde“. In der Heimat ihres Vaters heißt sie „Kokosnuss“. Außen braun, innen weiß. Ein Halt bleibt Oma Rita aus dem kleinen thüringischen Heimatdorf, deren Leben aus Arztbesuchen und Fernsehsendungen besteht.
Olivia Wenzel erzählt von Ängsten und Sehnsüchten der Generation Smartphone. „Alle dreißig Minuten schalte ich mein Handy ein, um nachzusehen, ob mich irgendjemand nicht erreicht hat, streame Kinderserien und Romcoms, harmloser Input für den verhärmten Körper“. Einziger kleiner, feiner Unterschied. Ihre Heldin ist schwarz – wie sie. Anders sein ist Alltag, ständig Blicken ausgeliefert zu sein. Manchmal erlebt sie Gewalt und Diskriminierung. Let´s talk about race. Was wäre wenn … überlegt Olivia einmal … wenn weiße Frauen in Büros putzen müssten, in denen gutverdienende, schwarze Hipster über neueste Netflix-Serien plaudern.
1000 Serpentinen Angst erzählt souverän und witzig über das Erwachsenwerden. Olivia Wenzel ist jung, schwarz und ostdeutsch. Der Stoff, aus dem sie schöpft. Auch ihre Motivation, da sie es leid ist, Sprüche wie – hat es bei dir letztens gebrannt?- kommentarlos stehen zu lassen. Im Buch träumt sie einmal von einem „völlig unambitionierten Miteinander“. Was wäre, wenn … „vielleicht eines Tages mein Kind, meine Großmutter, meine Mutter und ich auch so zusammensitzen würden“. Ohne Angst, ohne Vorurteile, ohne Mobbing. Auch wenn die Thüringen-Oma wieder das letzte Wort hätte: Kindchen, was hast Du jetzt schon wieder zu meckern?