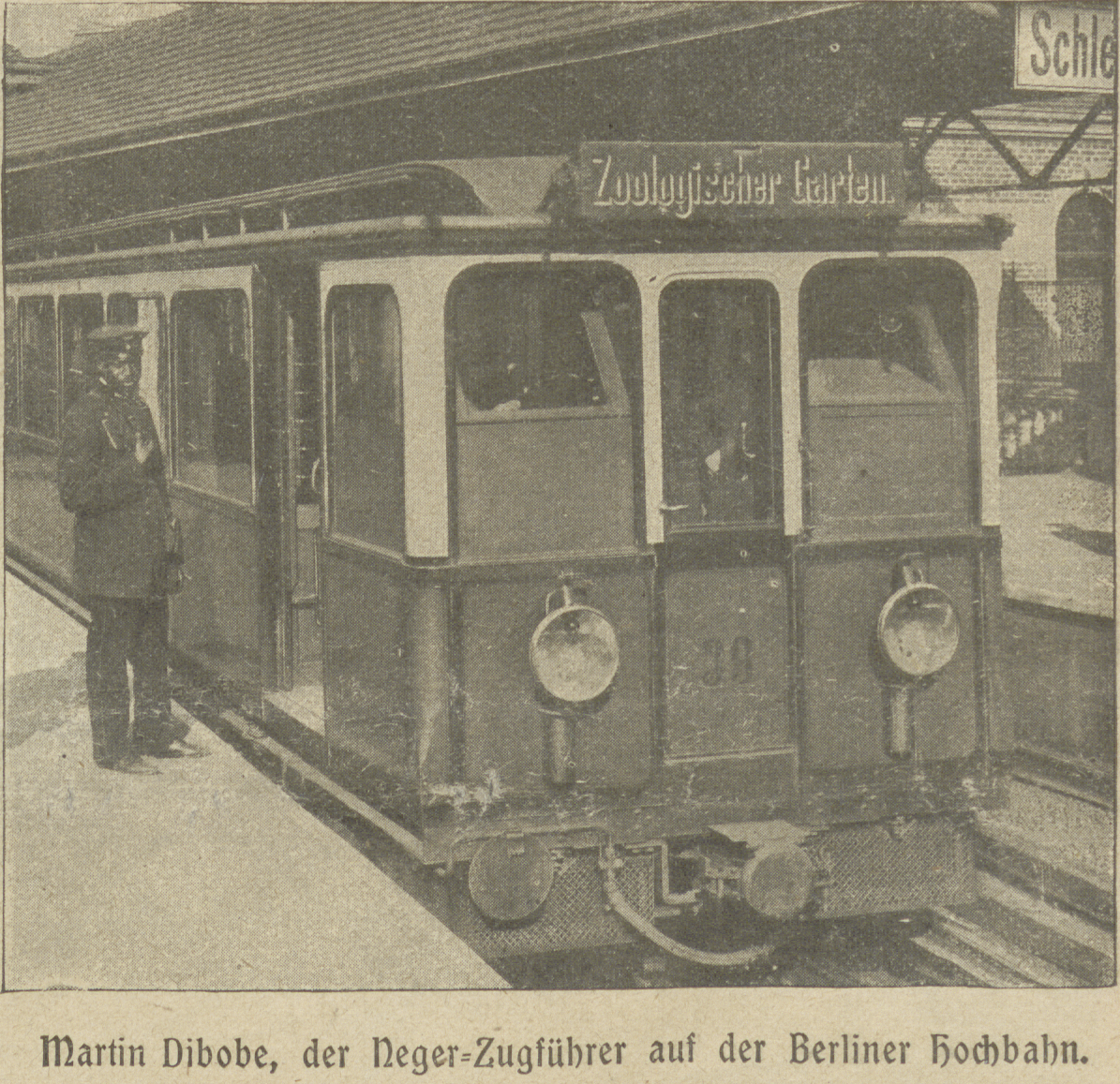Esbjörns Elevation
Wir leben in einer Welt, „in der ein falscher Tweet, ein falsches Wort sofort sanktioniert wird. Das führt bei vielen zu angstvollem Schweigen und gereinigter Sprache“. Das notiert die Schriftstellerin Eva Menasse. Ist das die Lage? Die einen fürchten sich vor Flüchtlingen, andere vor Corona, wiederum andere vor dem Internet. Der populäre Pranger. Unser Marktplatz für virtuelle Inquisition, Einschüchterung, Drohungen. Früher wurden Abweichler ans Kreuz genagelt oder verbrannt. Jesus, Jeanne d´Arc, Galileo Galilei… die Liste ließe sich beliebig verlängern. Natürlich alles im Namen der Moral und Reinheit der Lehre.
Ich widerrufe. Anklage und Unterwerfung. Eine unheilige Tradition. Die Menschheitshoffnung des letzten Jahrhunderts – angetreten als Sozialismus – hat besonders bizarre Blüten hervorgebracht. „Falls nötig, kann das Geständnis noch ausführlichere, detailliertere und präzisere Formen annehmen.“ So Nikolai Iwanowitsch Bucharin vor seinen Richtern im Moskauer Schauprozess. Unter der Anklage der Spionage wusste sich Bucharin, ein kluger Philosoph und Wirtschaftstheoretiker, nicht anders zu rechtfertigen. Sein Vergehen? Er kam vom rechten Weg ab. Das war in Stalins Reich zu viel.
Genosse Vordenker Bucharin galt lange als „Liebling der Partei“ (Lenin) und „Gehirn des Kommunismus“ (Ruth Fischer). Er wurde am 13. März 1938 im Alter von fünfzig Jahren erschossen. Hingerichtet mit dem früheren Geheimdienstchef Genrich Jagoda und weiteren ehemaligen Spitzenfunktionären. NKWD-Chef Nikolai Jeschow beaufsichtigte persönlich die Exekution. Er ließ Bucharin zusehen, wie die anderen Verurteilten vor ihm erschossen wurden. Auch den Genossen Geheimdienstchef Jeschow ereilte das Schicksal der „Säuberung“. Er wurde am 4. Februar 1940 erschossen. Die Revolution fraß ihre Kinder.
Wollen wir im gegenwärtigen Empörungsmodus wieder zurück auf solche Wege? Facebook, Twitter und Telegram als Stalinorgeln des 21. Jahrhunderts? Andersdenkende, Abweichler, Politisch Unkorrekte am Ende an die Wand stellen?
Das Netz fasziniert mich. Das Internet, gut 25 Jahre alt, ist längst unser tägliches Brot. Das Salz in der Suppe des Lebens. Mir hilft eine Sache zuverlässig, wenn ich mal wieder keine Antworten auf meine Fragen finde. Musik. Für mich die beste aller Möglichkeiten. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Wie wäre es mit Esbjörn Svensson? Ein Tastenvirtuose der Extraklasse. Ein Schwede, der das gewisse Etwas in den Fingern hatte. Leider hatte. Denn er ertrank beim Tauchen. Sein Sohn wartete am Ufer auf ihn. Elevation of love hat er uns geschenkt. Eines seiner vielen wunderbaren Stücke. Eine wohltemperierte Alternative zu den dauerempörten Anklägern im Netz – ob mit dem Gender* oder ohne *.
Jagende, die im Namen der Reinheit der Lehre alles Menschliche säubern wollen. Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, ihren kleinen und großen Dummheiten.