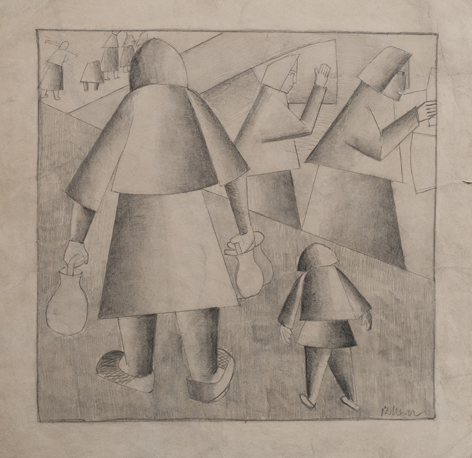Verteidigung des Abendlandes
Das Haus steht im Nirgendwo. Nächster Nachbar ist Frau Merkel mit ihrem wuchtigen Kanzleramt, Waschmaschine genannt. Ansonsten hoppeln ein paar Kaninchen durch den abendlichen Tiergarten. Abseits und doch mittendrin im Berliner Regierungsviertel steht die Schweizerische Botschaft. Frau Botschafterin Schraner Burgener, die tüchtige Vertreterin ihrer Eidgenossenschaft, lädt zum Empfang. Sie wirbt für Dichter und Denker des kleinen Alpenvolkes. Eine Handvoll der 70 Schweizer Verleger präsentieren ihr Programm.

Links geht es rein. Tradition und Moderne. Die Schweizerische Botschaft seit 2000 in Berlin. Quelle: Diener & Diener.
Durch ein Tor im Altbau, nach erfolgter Einlass- und Gesichtskontrolle führen breite Stufen in das Hochparterre einer stattlichen Gründerzeitvilla. Der Besucher ist beeindruckt: Viel Stuck und Ornament, Parkett und Flügeltüren, Samtbezüge an den Wänden und Kronleuchter an den Decken. Das Palais atmet den morbiden Charme des Großbürgertums. Das Gebäude der Schweizerischen Botschaft diente ab 1870/71 dem Arzt Frierich Frerichs als Praxis. Einer seiner Patienten, der Schriftsteller Dostojewski staunte: „Diese Leuchte der deutschen Wissenschaft wohnt in einem Palast.“

Ein Haus abseits aber mittendrin. Die Schweizerische Botschaft in Berlin-Mitte. Seit knapp 100 Jahren Sitz der Eidgenossenschaft.
Als sich Internist Frerichs zur Ruhe setzte, wechselte die Arztpraxis im Alsenviertel mehrfach den Besitzer. Rauschende Bälle wurden im Palast gefeiert bis I. Weltkrieg und Revolution einen weiteren Wechsel brachten. Die Schweiz kaufte 1919 das Palais und hisste fortan das weiß-rote Kreuz Helvetias am Himmel über Berlin. Als die Nazis an die Macht kamen, rissen sie das Alsenviertel ab. Hier sollte am Schnittpunkt der gigantischen Nord-Süd-Achse der Mittelpunkt Germanias entstehen. Auch die Botschaft sollte für die neue Halle des Volkes weichen.
Eine Ersatzresidenz wurde für die neutrale Schweiz in der Tiergartenstraße errichtet. Doch alles kam anders. Der Krieg stoppte 1942 weitere Abrissarbeiten. Die Botschaft überlebte. Das Haus der kleinen Schweiz blieb als einziges Gebäude im Spreebogen des Alsenviertels stehen. Im April 1945 besetzte die Rote Armee die Schweizer Gesandtschaft. Von dort aus stürmten Stalins Stoßtrupps den Reichstag. Das verbliebene Botschaftspersonal wurde während der Kämpfe im Keller eingesperrt und später nach Moskau gebracht. Via Türkei kehrten die Schweizer Diplomaten später in die Schweiz zurück.
Die Teilung Berlins drückte die Botschaft an der Bismarck-Allee 1 an den Rand der Ost-West-Grenze, mitten ins Niemandsland. Mehrfach versuchte die Schweiz ihren letzten Restposten zu verkaufen. Doch niemand wollte das einsame Haus an der Grenze haben. „Ein Glück“, schmunzelt Frau Botschafterin. Nach dem Fall der Mauer wollte die Bundesregierung das Palais einverleiben. Doch die Schweizer blieben hartnäckig. Im Jahr 2000 eröffneten sie ihre Botschaft nach über fünfzig Jahren Funkstille vergrößert um einen modernistischen Anbau. Mitten im neuen Regierungsviertel.
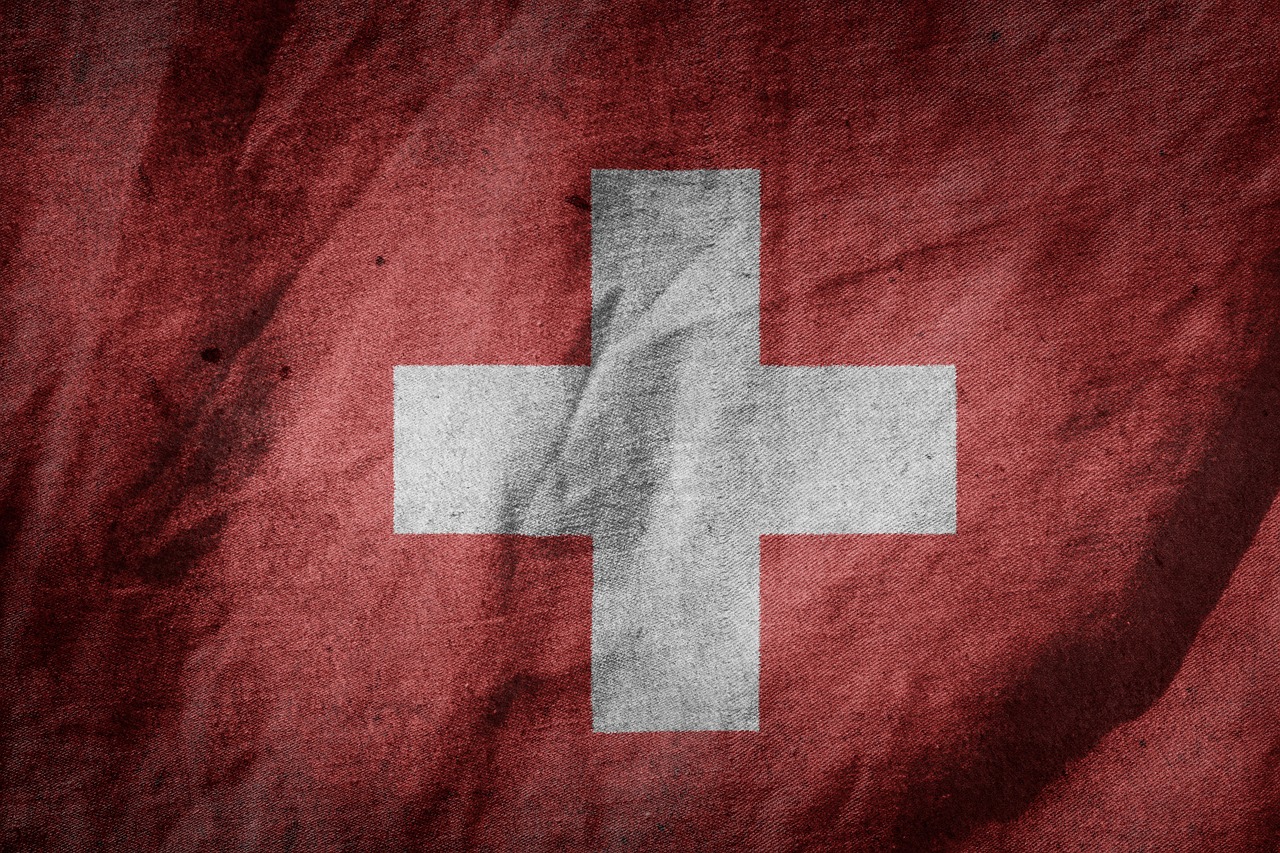
Im Zeichen des Kreuzes. Im Jahr werden in der Schweiz 16 Millionen Bücher verkauft. Tendenz stabil. Die Zahl der Kontobücher soll deutlich höher liegen.
So können heute Literaturfreunde bei Käsehappen und Rotwein über den Untergang der abendländischen Kultur plaudern. Die Verleger klagen über knausrige Leser. Ein Schnitzel hält zehn Minuten. Ein Buch für den selben Preis eine Woche und länger. Sie schimpfen über ungeduldige User, die lieber IPads und Internet als das gute alte Buch konsumieren. Doch die Schweizer bleiben von Natur aus konservativ. Sie habe das Geschenk zum 50. Geburtstag, ein Kindle-Lesegerät, abgelehnt, betont stolz Botschafterin Christine Schraner Burgener. Das Publikum im Kronleuchter-Saal nickt erfreut. Es ist, als ob Dostojewski gleich die Flügeltür öffnen würde. Es könnte ihm hier gut gefallen, bevor er mit einem Augenzwinkern den Salon wieder geräuschlos verlässt.