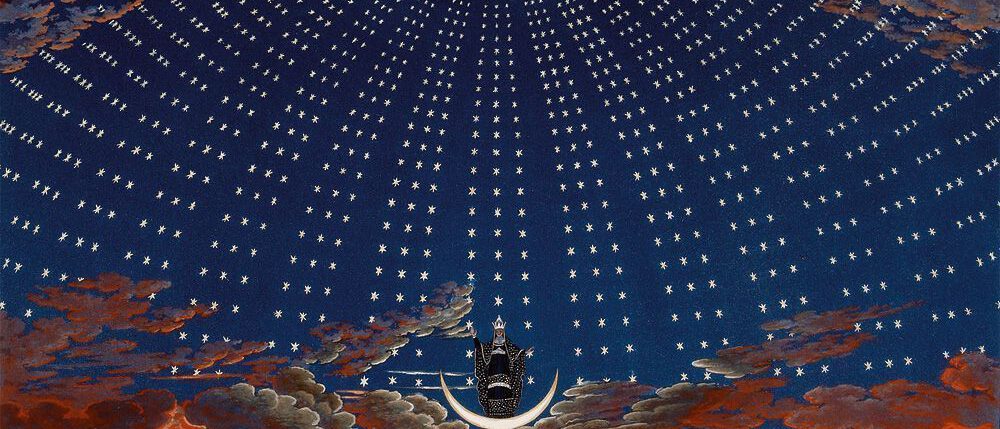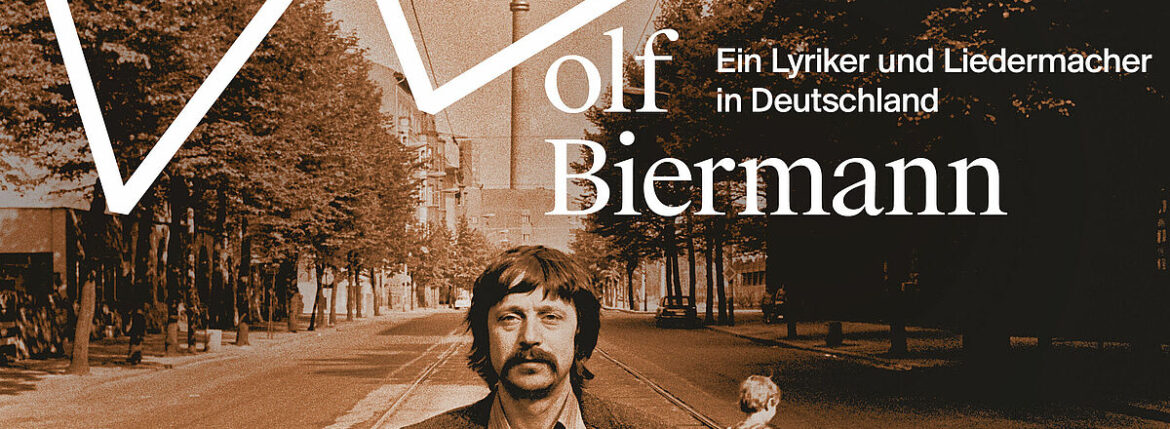Wir sind Weltmeister
Acht Spiele, acht Siege. Ein deutsches Team ist zum ersten Mal Weltmeister. Kein hochbezahltes DFB-Fußball-Team. Weder Herren noch Damen. Keine Handballer, keine Leichtathleten, die ohne eine einzige Medaille bei der letzten WM blieben. Es ist eine deutsche Randgruppensportart: Basketball. Früher nur in Uni-Städten oder US-Stützpunkten gespielt. Die Vorbilder kamen aus den dem früheren Jugoslawien oder – ganz klar – aus den USA. Jetzt hat eine deutsche Auswahl die Lehrmeister des Sports besiegt. Erst gewannen die Deutschen gegen die USA, dann im Finale gegen Serbien. Eine Sensation, melden die Medien, die bis zum WM-Titel die Erfolge der Korbjäger konsequent ignoriert hatten. So läuft das Geschäft. Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Plötzlich werden in unserer erschöpften Gesellschaft wieder Teamgeist und Leistungswille gefeiert. Basketball ersetzt ausgebrannte Fußballstars. Wie schön, wie wunderbar.
Höhepunkte aus dem besten Spiel der WM: Deutschland vs. USA. Halbfinale
Sport konnte schon immer Außenseitern eine Chance geben. Die Bereitschaft sich zu quälen, um besser zu sein, wird mit Aufmerksamkeit und Anerkennung entlohnt. Später mit Profi-Verträgen und sozialem Aufstieg. Basketball bleibt wohl in Deutschland weiter eine Schattensportart. Zwar haben viele aus der WM-Mannschaft in den USA oder in der Euro-League gut dotierte Verträge. Doch Kicker verdienen mittlerweile utopische Summen. Nur ein Beispiel: Für die 100 Mio. Euro, die Bayern München für Harry Kane hingelegt hat, könnte man etwa 21 Millionen Kinder ein Jahr lang ernähren. Vielleicht erklärt sich das fehlende Engagement der kickenden Stars für ihre Nationalmannschaften mit dem totalen Triumph des Kommerzes über Ideale, Sport und Mannschaftsgeist. Wenn am Ende nur das Ich zählt, dann geht es nur noch um die optimale Vermarktung.

Die Basketball-Kathedrale von Moerdijk. Aus einer Kirchenruine entstand 2019 ein Sportzentrum. Entdeckt in Süd-Holland.
Der Weltmeister-Titel der Basketballer setzt eine Begeisterung frei, wie einst bei den Fußballern in Bern 1954. Motto: Ihr müsst zusammenhalten und ein Team sein. Doch der Erfolg mobilisiert reflexartig digitale Miesepeter und Heckenschützen. In Internetforen wird gegen farbige Spieler im deutschen Team gestichelt und gehetzt. Gott bewahre! Was für armselige Kleingeister! Ohne diese Mischung hätte das Team nie eine Chance gehabt. Isaac Bonga ist in Neuwied geboren. Sein Vater stammt aus dem Kongo. Johannes Thiemann stammt aus Trier, sein Vater kommt aus Kamerun. Zu ihm hat er nur wenig Kontakte. Superstar Dennis Schröder ist in Braunschweig aufgewachsen. Seine Mutter führte in Gambia einen Friseursalon. Der Vater ist Deutscher. Sein Talent hat ihn in die beste Liga der Welt geführt: in die NBA der USA.
Maodo Lo ist ein typischer Berliner Junge. Sein Vater aus dem Senegal studierte an der Spree. Er verliebte sich in die Künstlerin Elvira Bach. Maodos Mutter ist eine renommierte Malerin, ihre Ideen setzt sie in einem Kreuzberger Atelier um. Elvira Bach hat ihren Sohn nie zum Training geschickt. Heute malt sie ihn und ist von seinem Erfolg begeistert. Was zählt im Leben? Selbstvertrauen plus Teamgeist. Besonders Jugendliche aus Brennpunktbezirken können davon profitieren. Streetball, „der kleine Bruder“ vom Profi-Basketball, wird genau dort gespielt, wo sich niemand um Kids kümmert. Der Ball muss in den Korb. Das ist entscheidend. Niemand trifft immer. Aber es gibt stets die zweite Chance. Im Basketball wie im Leben.