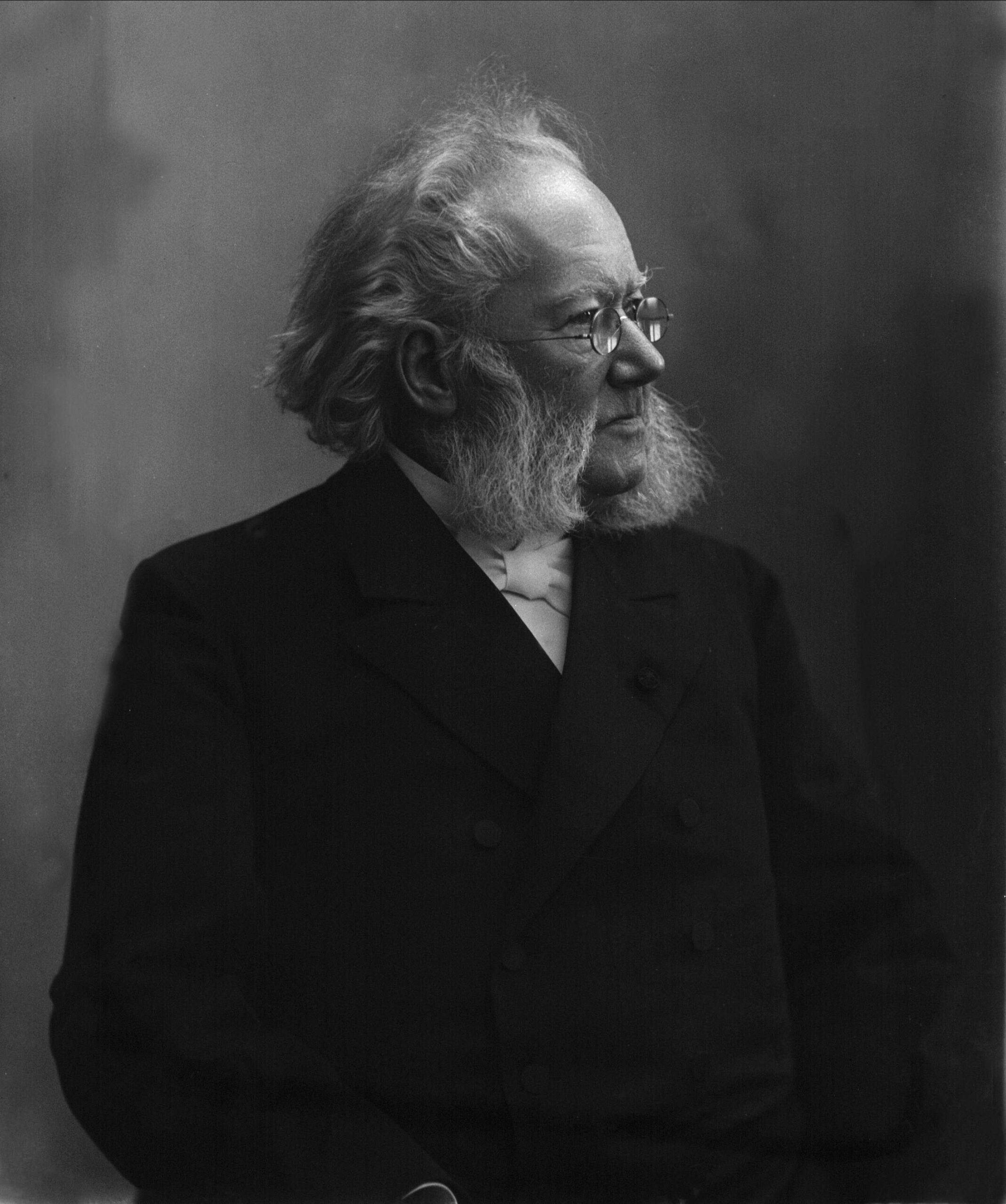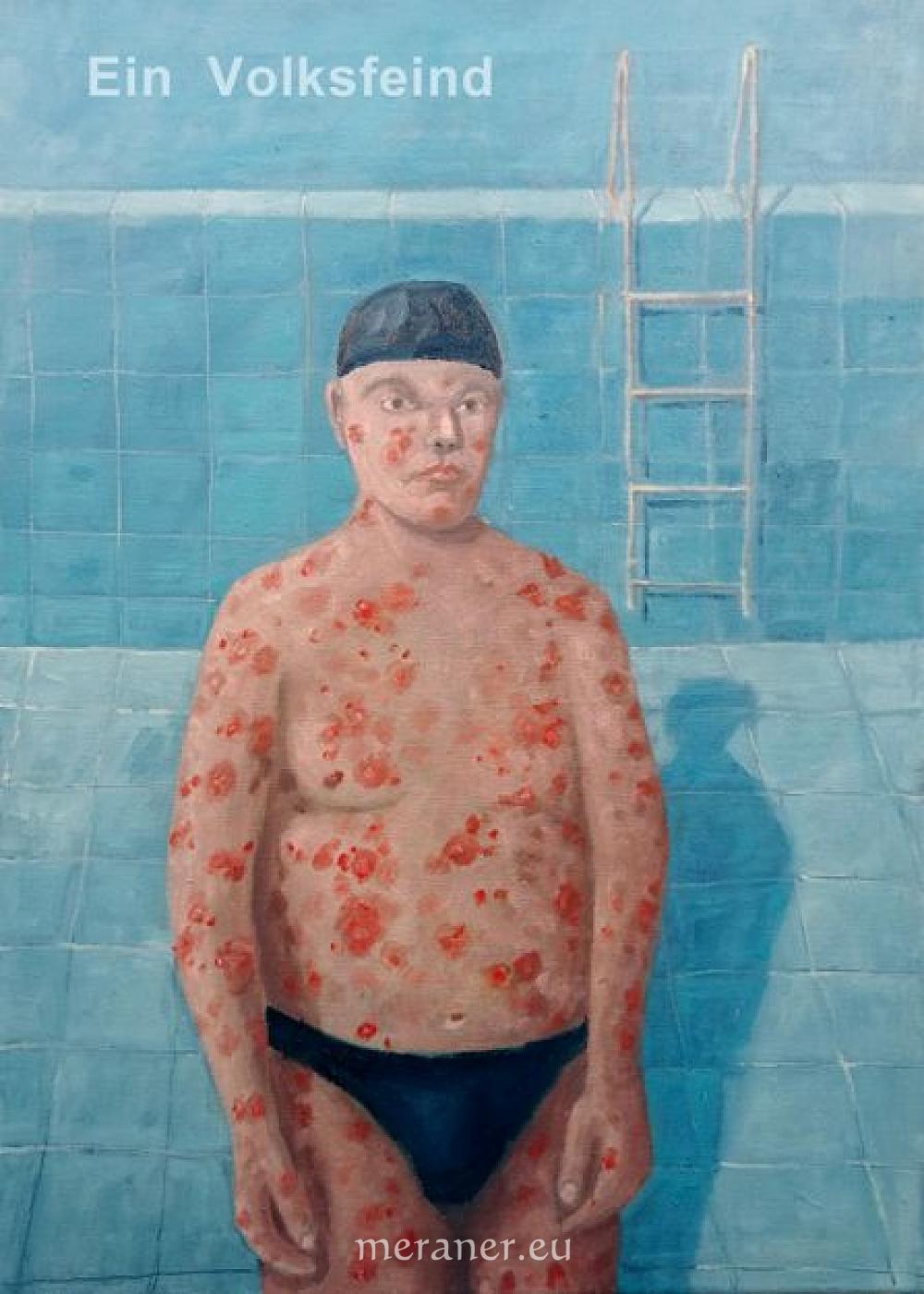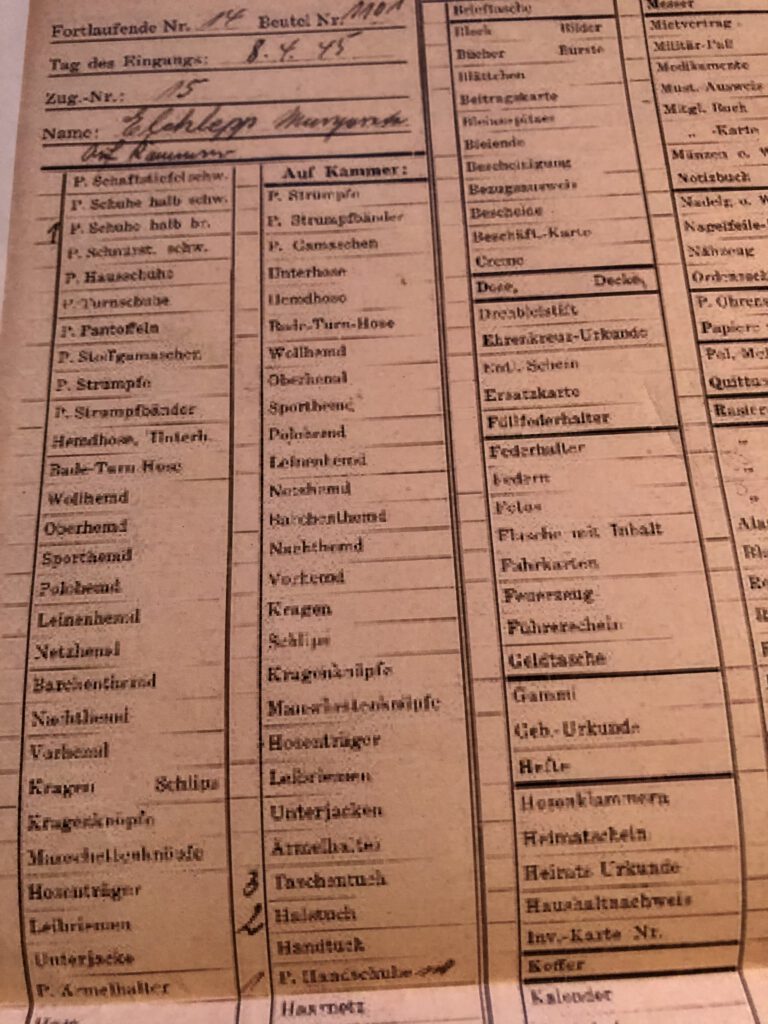Denken ohne Geländer
Manhattan, 4. Dezember 1975. Plötzlich wollte das Herz nicht mehr. Es beschloss stehen zu bleiben. Das Herz von Hannah Arendt. In der Schreibmaschine steckte die erste Seite eines neuen Textes über „Das Urteilen“. Am nächsten Tag wollte die 69-jährige streitbare Denkerin loslegen. Von Arendt stammt der Satz: „Der Sinn von Politik ist Freiheit und nicht Einschränkung.“ Freies Denken und der Streit um den richtigen Weg waren der Motor ihres Lebens. Dabei war die Kettenraucherin eine Außenseiterin hoch drei. Sie war Jüdin, Frau und Intellektuelle. Zweimal musste die Bürgertochter aus Königsberg neu anfangen. 1933 nach der Flucht aus Hitler-Deutschland. 1941 als Exilantin in New York.
„Wir sind nicht geboren, um zu sterben, sondern um gemeinsam etwas Neues anzufangen.“ Typisch Arendt. Wir sollten unsere Tage besser mit konkretem Handeln nutzen bevor wir wieder in jenem „Nirgends“ verschwinden, aus dem wir gekommen sind. Bei unserem Verschwinden würde „der Kosmos nicht einmal zucken“, meint sie augenzwinkernd. In ihrer speziellen Mischung aus Schnoddrigkeit und Schärfe beschreibt sie das Lebensgefühl des modernen Menschen, in dem jede Freiheit von Anpassung, Sach- und Leistungszwängen erdrückt werde. Bürger hätten brav zu sein, sollten Dinge herstellen und verbrauchen, auch diejenigen, die sie gar nicht brauchen. Durch kapitalistische „Vergeudungswirtschaft“ verlören „ganze Bevölkerungsschichten ihren Platz in der Welt“. Die Gesellschaft dränge auf Veränderungen, doch Machteliten schotteten sich ab. Experten behaupteten beschwichtigend, die Gesellschaft sei eben so komplex wie die Evolution. Das schrieb sie vor über fünfzig Jahren.
Scharf kritisiert Hannah Arendt „die Religion des Eigentums“. Sie bekümmert, dass Bürgern „Meinungen und Gesinnungen wie Seifenpulver und Parfum“ verkauft werden. Die blockierten sozialen Kämpfe verwandelten sich am Ende in Kulturkämpfe. (Heute wären das Gendern und Identität). In Stellvertreterdebatten werde nur noch aggressiv gestritten, nicht jedoch das Gemeinsame gesucht. Für Arendt war klar, dass in fragmentierten Teilwelten keine kommunikative Macht entstehen kann. Anything goes. Alles geht, aber das mit voll aufgedrehter Lautstärke.
Gegen ihre Morgenmelancholie half eine Tasse Kaffee und natürlich Zigaretten. Wer raucht, denkt, war ihr Credo. Natürlich irrte auch die Dame aus Manhattan, manchmal sogar gewaltig. Ihr berühmter Gedanke über den NS-Schreibtischtäter Adolf Eichmann von der „Banalität des Bösen“ kostete der Philosophin 1964 viele Freundschafen. Man warf ihr „Originalitätssucht, Arroganz und Verrat an der jüdische Sache“ vor. Sie erntete jahrelang gewaltige Shitstorms. Aber sie blieb dabei: „Eichmann ist ein Hanswurst. Das nahmen mir die Leute übel.“ Die Geschichte gab ihr Recht. SS-Täter Eichmann war kein Dämon, er war ein Bürokrat. Die Banalität des Bösen.
Eigenständiges Denken ist und bleibt ihr Vermächtnis. Dinge verstehen wollen. Suchen, Nachdenken. Wie genial einfach ist dieser innere Kompass und wie schwer ist ihm zu folgen. Gerade in heutigen Zeiten von Twitter-Gewitter, Cancel Culture und selbstgerechter, moralischer Belehrung. Zum Schluss daher lieber noch einer dieser typischen Arendt-Sätze: „Wenn die Weltgeschichte nicht so beschissen wäre, wäre es eine Lust, zu leben.“