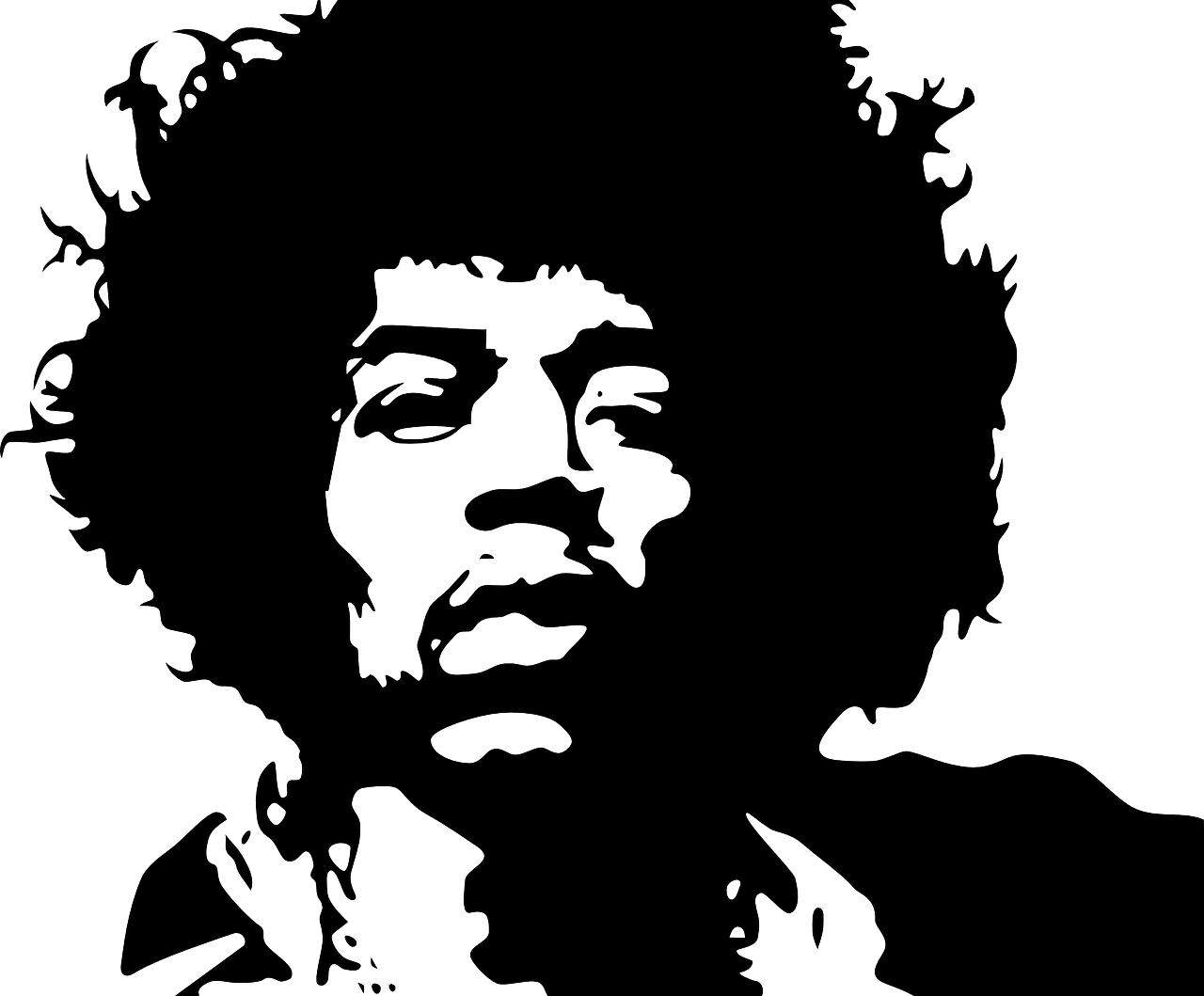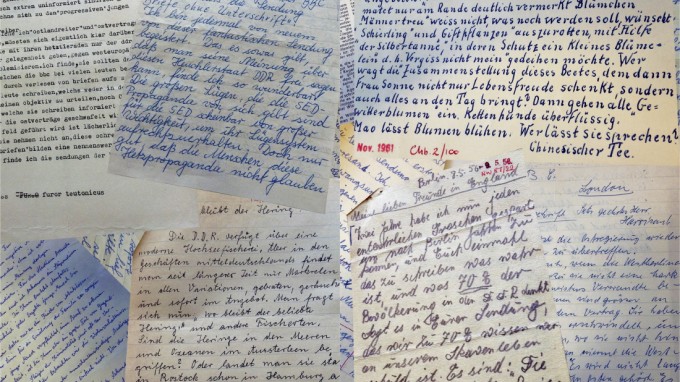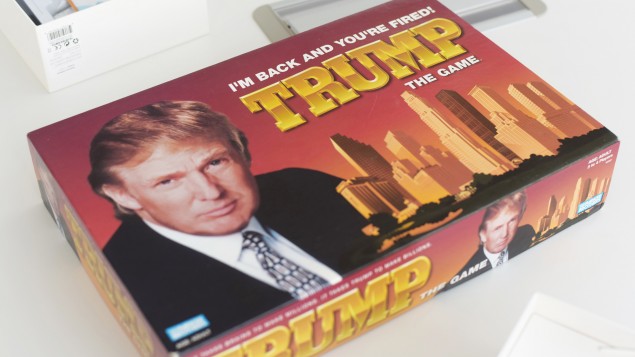Großes Kino
Der letzte Schauer ist gerade übers Land gezogen. Eine feuchte Wiese am Ende der Welt. Am Rande steht ein knallrotes Magirus-Feuerwehrauto, dazu ein kleines Zelt, ein paar Bänke. Das Wanderkino ist da. In Warnkenhagen – im Niemandsland zwischen Lübeck und Wismar. In der Ferne rauscht die Ostsee. Ein privater Gastgeber hat sein Gelände geöffnet. Es gibt selbstgebackene Pizza, einheimisches Bier und über Hundertjahre alte Filme. Stummfilme in Schwarz-Weiß mit kleinen und großen Helden.

Das Wanderkino braucht eine kleine Wiese, gutes Wetter und eine stabile Stromversorgung. Dann kann es losgehen!
Bei Einbruch der Dunkelheit hat sich eine große Schar Interessierter eingefunden. Das Publikum trotzt dem nassen Regensommer. Einheimische und Urlauber. Kinder, Opas, ganze Familien. Der Eintritt ist frei. Alle sind blitzgespannt. Dann eine kurze Ansprache des Gastgebers. Es kann losgehen. – Doch als würde aus heiterem Himmel ein Blitz von oben herabsausen, fällt der Strom aus. In Sekundenschnelle herrscht Dunkelheit. Dann Ratlosigkeit. Schließlich emsige Suche nach den Ursachen. Plötzlich flackert das Licht wieder. Der Generator springt an. Jetzt geht es wirklich los. Das Wanderkino in Warnkenhagen.
Es kommt Leben auf die nächtliche Wiese. Die kleinen Strolche ziehen los, um ihre Streiche zu spielen. Charlie Chaplin ist der Abenteurer von 1917, immer auf der Flucht vor den Gesetzeshütern. Harald Lloyd balanciert in atemberaubender Höhe. Unentwegt auf der Suche nach dem kleinen und großen Glück. Den Sound liefern Tobias Rank am Piano und Gunthard Stephan auf der Violine. Besser als jedes youtube-Mäusekino. Ein herrlicher Sommerspaß. Großes Live-Kino auf der Wiese. Am Ende prasselt der Beifall in den Augusthimmel. Jeder kann spenden so viel er will. Die Büchse füllt sich.
Noch bis Oktober ist das Leipziger Wanderkino unterwegs. Von der Ostsee bis zum Weißwurstäquator. Die Kinowandergesellen treten bevorzugt in Dörfern und Kleinstädten auf. Einzige Station in der Nähe von Berlin ist am 26. August 2017 in Erkner vor dem Gerhard Hauptmann-Museum. Wenn es trocken bleibt und der Generator durchhält, heißt es dann wieder: Film ab!