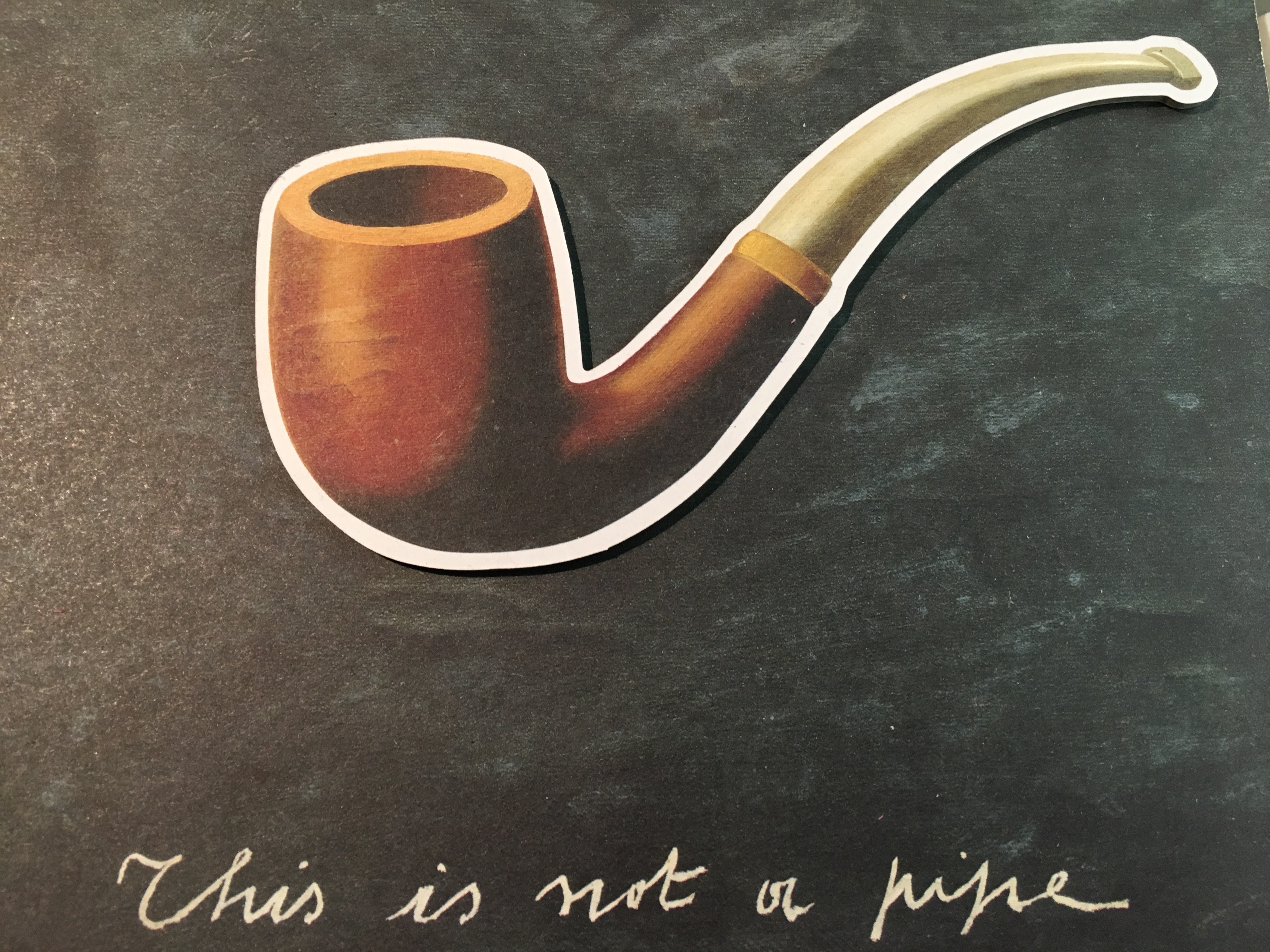Babylon Berlin – U-Bahn-Gott
Die Bahn rumpelt Richtung Osten. Ein Sonnabend im Advent. Mittagszeit. Der Zug ist gut gefüllt. Ein beleibter Straßenmusiker entert den Wagen. Sofort legt er auf seiner Gitarre los. Er trällert ein amerikanisches Weihnachtslied. Die Fahrgäste lassen es über sich ergehen und ertragen seinen Vortrag teilnahmslos. Keiner schaut hin. Wie immer. Am Ende seines Liedes wünscht der Musiker mit britischem Akzent „Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Salam Aleikum.“ Der Gitarrist zückt den Hut, um sein Honorar einzusammeln, als ein Mann mit Bart, Mitte dreißig, laut und deutlich ruft: „Du hast meinen Gott beleidigt.“
Für einen kurzen Moment herrscht so etwas wie Irritation im Abteil. „Mein Gott?“ Ich sitze mehrere Reihen entfernt. Anspannung liegt in der Luft. Plötzlich geht der Mann an der Tür auf den Musiker los. Er brüllt voller Hass: „Du hast Allah beleidigt. Du bist ein Ungläubiger.“ Die letzten Worte sind nicht richtig zu verstehen. Der Musiker wiegelt ab. „Ich habe allen ein frohes Weihnachten gewünscht. All People here. Fuck. That´s it.“ Der Bärtige hebt die Fäuste. Der Musiker ruft: „Damned. Du hast mir nichts zu verbieten!“ So stehen sie sich nicht einmal eine Armlänge entfernt gegenüber. Der Vulkan spukt Feuer, droht zu explodieren.

„U-Bahnfahren ist wie Schule. Eine Menge Leute sitzen auf engstem Raum und warten bis es vorbei ist.“ Werbespruch der Berliner Verkehrsbetriebe BVG.
Da geschieht ein kleines Wunder. Eine schmale Frau stellt sich zwischen die Streithähne, redet auf den Bärtigen ein, er solle sich wieder einkriegen, der Musiker habe es nicht so gemeint. „Vertragt Euch“, ruft sie. Und: „Nicht hier. Das geht gar nicht.“ Ein Vater, der mit seinem Kinderwagen direkt neben den Männern steht, schiebt seinen kräftigen Körper zwischen die Kontrahenten, drängt den schimpfenden Muslim ab, trennt die Hitzköpfe. Eine zweite, großgewachsene Frau, Mitte vierzig, eilt hinzu. Stellt sich gleichfalls beschwichtigend vor den Bärtigen. Das alles passiert in wenigen Sekunden. Der Zug hält am nächsten Bahnhof.
Die Streithähne lassen voneinander ab, steigen an verschiedenen Türen aus. Draußen rufen sie sich weiter wüste Schimpfworte zu. Ihre Wut hallt durch den Bahnhof. Aber: sie gehen getrennte Wege. Die Prügelei wegen Gott und Weihnachten konnte um eine Haaresbreite verhindert werden. Die Türen schließen. Die Bahn fährt weiter. Allmählich stellt sich der übliche Großstadt-Blues wieder ein. Alle atmen auf. Die drei beherzten Mitfahrer haben durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindert.
Eine bizarre Alltagsepisode, verstörend, aber eigentlich nicht mehr. Ich hätte sie längst vergessen. An manchen Tagen ist das Aggressionspotential auf hohem Level. Ein falscher Blick zur falschen Zeit, ein Rempler, das kann Folgen haben. Man lernt damit umzugehen, verhält sich streetwise. Aber die kleine Szene geschah wenige Tage vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Das war im Dezember 2016. Da konnte keiner mehr dazwischen gehen. Eine bange Frage bleibt: An welchen Gott glaubt dieser Mann?
***
Fortsetzung folgt.