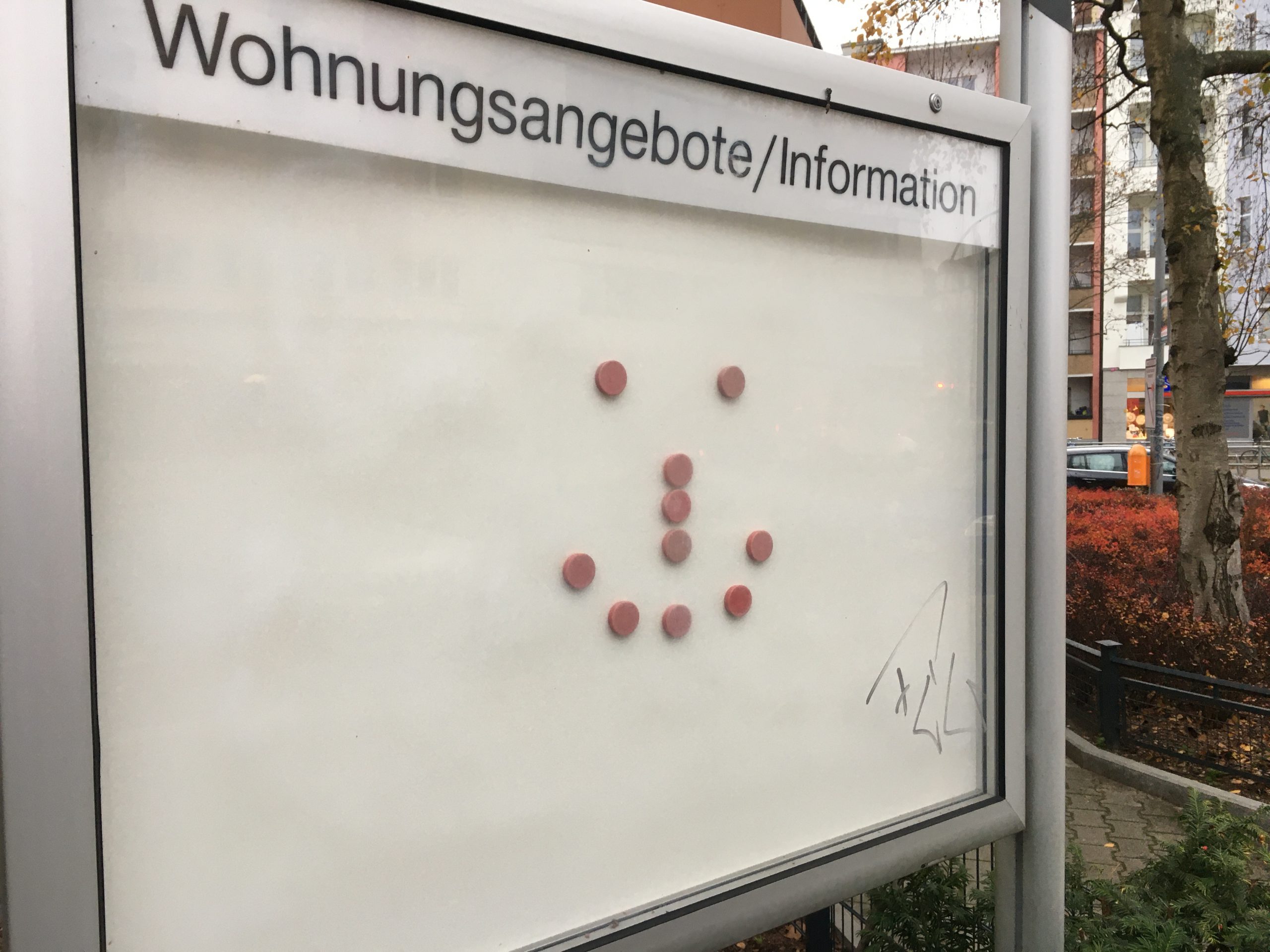Von Siegern und Besiegten
Posted on: 7. November 2019 /
Der dreißigjährige Frieden seit dem Mauerfall ist ein Grund zum Feiern. Das findet eine Mehrheit der Deutschen laut Umfragen. Doch die Ruhe trügt. Unter dem Einheits-Jubel gärt es kräftig. Ist das berechtigter, nachvollziehbarer Frust oder selbstgerechter Wohlstandsblues einer verwöhnt-überempfindlichen Gesellschaft?
Sieger schreiben Geschichte. Das heißt: es gibt auch Besiegte. Diese schweigen, ziehen sich grollend zurück, verbittern. Ist folglich die AfD die logische Antwort auf die letzten dreißig Jahre? Bedeutet die Wahl in Thüringen den Einstieg in den Ausstieg aus alten Gewohnheiten, Mustern und Illusionen der vereinten Bundesrepublik? In diesem prosperierenden Bundesland wählten vor kurzem mehr als 55% scharf Rechts oder scharf Links. Die sogenannte Mitte aus CDU und SPD kam nicht einmal auf ein Drittel Zustimmung. Wer ist nun nach dreißig Jahren Sieger, wer Besiegter?

Pariser Platz. Ostseite Brandenburger Tor am 10. November 1989 früh. Foto: Andreas Schoelzel
Zur Erinnerung einige Momentaufnahmen aus der Nacht vom 9. November 1989 am Brandenburger Tor. Zusammengestellt aus Lageberichten der DDR-Grenztruppen, Volkspolizei, Ministerium für Staatssicherheit, (West)Berliner Polizei und eigenem Erleben als einer der wenigen TV-Journalisten vor Ort zwischen 23 Uhr und 4.30 Uhr früh am 10. November 1989. Eine Nacht, in der nichts blieb wie es war. Eine Nacht, die alles veränderte.
Lageberichte Brandenburger Tor. Donnerstag, 9. November. 11 Grad.
21:00 Dienstwechsel bei den Grenzregimentern.
22:00 Ein Zug der OHS Suhl (Offiziershochschule) wird zum Checkpoint Charlie abkommandiert.
22:44 Uhr Lagemeldung der West-Berliner Polizei. Menschenmenge auf 400-500 Personen angewachsen
22:45 Uhr Lagemeldung Volkspolizei-Inspektion Mitte. 50-60 Personen am Sperrzaun B-Tor.
23:05 Uhr Der einzige schriftliche Befehl des MfS (Ministeriums für Staatssicherheit) am Abend der Maueröffnung ist ein chiffriertes Fernschreiben, den die HA VI (Passkontrolle) um 23:05 Uhr an die grenznahen Bezirksverwaltungen für Sicherheit übermittelte. „Neben dem Lichtbild im Personalausweis – rechts – ist ein Passkontrollstempelabdruck anzubringen, der zugleich als Entwertungsvermerk gilt.“ (Abstempeln von Passfotos; Zählen)
23:50 Uhr „Mauerkrone wird erneut bestiegen“. Mehrere tausend Menschen auf Westseite. Auf Ost-Berliner Seite am Pariser Platz mehrere hundert Personen am Rollgitter.
23:57 Uhr „Panzermauer und Mauerkrone wird erneut bestiegen“. Grenztruppen setzen Wasserspritzen ein. Mehrere tausend Menschen auf Westseite. Auf Ost-Berliner Seite mehrere hundert Personen am Rollgitter.
23.59 Personen, die auf Mauer stehen, werden durch DDR-Grenzorgane mit Wasserstrahl von der Panzer-Mauer gespritzt.

Party am Brandenburger Tor. Feiernde Menschen. Ratlose Grenzer. Foto: Andreas Schoelzel
10. November 1989
00:10 Uhr Ca. 100 Personen dringen „über die Rollgitter in den Sicherungsbereich der Grenztruppen ein“
00:20 Uhr Befehl: GKM (Grenzkommando Mitte) in „erhöhte Gefechtsbereitschaft“ versetzen. Die GÜST (Grenzübergangsstellen) sollen mit Personal unterstützt, Reserven mobilisiert und herangeführt werden. Oberst Heinz Geschke: „Ruhe bewahren, Lage stabilisieren, keine Unfälle zulassen, in ruhige Bahnen lenken.“
00:30 Uhr: Live-Schalte US-Sender NBC auf Westseite mit Tom Brokaw. Im Hintergrund ist Wasserwerfer-Einsatz zu sehen. Der Mauerfall wird zum weltweiten Live-TV-Ereignis.
01:10 Uhr: Mauer wird wieder von Westseite bestiegen. Grenzer greifen nicht mehr ein. Auch von der Ostseite klettern Menschen auf die Panzermauer. Beginn der Party auf der Mauer.
01:10 Uhr Eine Menschenmenge von ca. 300 Personen bewegt sich von Unter den Linden westwärts auf das B-Tor zu. Befehl, auf keinen Fall von Maschinenpistolen Gebrauch zu machen.
01:20 Uhr Die Zahl der „im Grenzgebiet sich aufhaltenden Personen wuchs in der Folge auf rund 500 an“.
Ein unvergesslicher Moment. Kein großdeutsches Imponiergehabe.

Ca. 4.30 Uhr. Der Pariser Platz ist wieder „besenrein“. Was bleibt? In der Stunde ihrer größten Niederlage errangen die DDR-Grenzer ihren größten Triumph. Am 9. November 89 schoss die Armee des Volkes nicht auf das Volk. Foto: Andreas Schoelzel
Das Klopfen der Mauerspechte geht den Grenzern durch Mark und Bein. Oberst Günter Leo: „Die Offiziere waren total konfus, die fühlten sich betrogen, hinters Licht geführt. Mit denen war auch nicht mehr zu reden. Für sie war der Sinn ihres Berufslebens, ihre Erde, ihre Würde zerstört.“
Oberst Hans-Joachim Krüger (MfS) und Generaloberst Wagner (Ministerium des Innern) am frühen Morgen des 10.11.89:
Wagner: „Es sieht schlimm aus. Soll ich dir mal was sagen?
Krüger: Na, sag´s!
Wagner: Der Sozialismus ist verloren. Sieh in die Augen der Menschen. Wir haben kein Hinterland mehr.“
01:30 Uhr Reservekräfte in Berlin-Wilhelmshagen, Oranienburg und am „Hölzernen See“ (OHS = Offiziershochschule) werden in Marsch gesetzt.
01:39 Uhr Elitetruppe der Bereitschaftspolizei in Basdorf wird mobilisiert.
Bis 02:00 Uhr Weitere 1.000 Personen dringen „von der Otto-Grotewohl-Straße (heute Wilhelmstraße) aus in den Sicherungsbereich ein und durchbrechen die Sicherungsketten der Grenztruppen, die „ohne jegliche Gewaltanwendung ihren Dienst versahen“.
03:00 Uhr „Insgesamt wurden 546 AGT (Angehörige Grenztruppen) im Abschnitt des Brandenburger Tores eingesetzt (inklusive der ständigen Sicherheitskräfte im Abschnitt BBT= Brandenburger Tor)“, dazu rund 100 VPs (Volkspolizisten).
03:30 Uhr Entwarnung der Volkspolizei
04:30 Uhr Lagebericht MfS: Pariser Platz zwischen Panzermauer und Rollgittern geräumt. Rund 2.000 bis 3.000 Menschen auf der Westseite.
06:00 Uhr Eintreffen einer Elite-Kompanie aus Perleberg (Offiziersschule)
Die Lage im „Objekt Schallplatte“ (Deckname der Grenztruppen für Grenzabschnitt Brandenburger Tor/Reichstag) hat sich beruhigt.