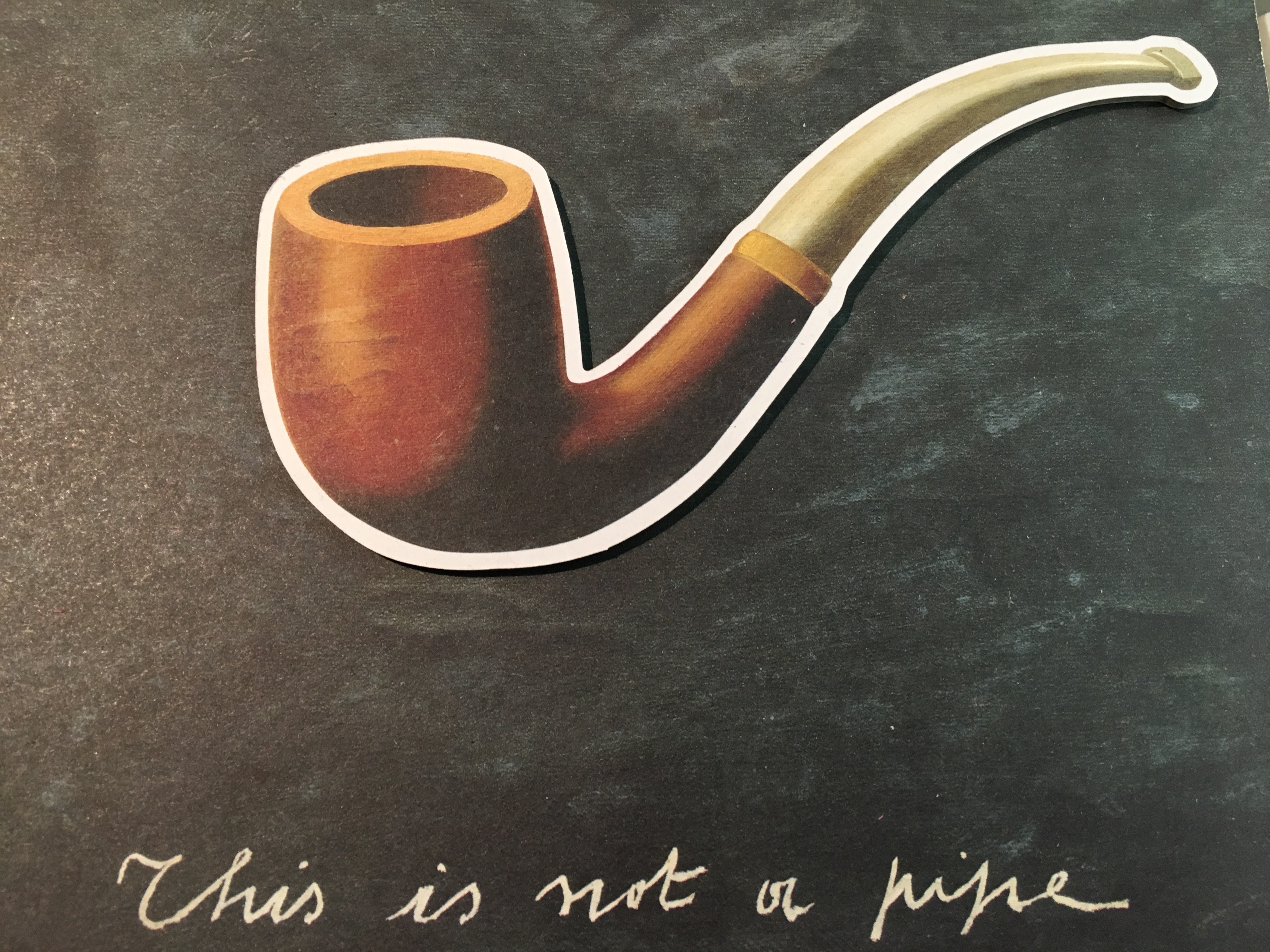Schlaflos in Pjöngjang (4)
Posted on: 27. Oktober 2017 /
3. Juni 2004
Premierenstimmung. Hektische Betriebsamkeit und eine Prise Aufgeregtheit. Der deutsche Lese-Saal soll heute im Kulturhaus Chollima offiziell eingeweiht werden. Das Protokoll ist streng. Die Funktionäre sind ein wenig nervös. Es ist heiß. Gegen die aufsteigende Hitze brummen zwei Aggregate an. Der neue Raum für Information, Kultur & Austausch hat sogar eine Klimaanlage, Made in Japan. An diesem Tag steht ein winziges Stück Weltpolitik auf dem Spielplan. Schauplatz: die ehemalige Rumpelkammer des nordkoreanischen Kulturinstituts.
Nach 50 Jahren Kalter Krieg ist diese Eröffnung eine kleine Sensation. Die Bücher von Martin Walser, Christa Wolf, Ralph Giordano, Elfriede Jelinek sind ab sofort ausleihbar. Werke von Autoren und Schriftsteller kommen zum ersten Mal in ein Land, in dem jedes einzelne Wort kontrolliert und zensiert ist. In den Regalen stehen dicke Biografien über Konrad Adenauer und Gerhard Schröder, bohrende Innenansichten deutscher Vergangenheiten von Jörg Friedrich und Hilke Lorenz. Präsentiert wird deutsches Wissen aus allen Zeiten, aus Mathematik, Physik, Chemie und anderen Wissenschaften. Selbstverständlich sind die Großmeister, die Klassiker der deutschen Dichtkunst Goethe und Schiller vertreten.

Antreten zur Einweihung des Goethe-Lesesaals in Pjöngjang.
Der stolze Vater des Pjöngjang-Projekts, der Deutsche Uwe Schmelter schwelgt und ist überglücklich: „Bei aller Unzulänglichkeit, das ist ein großartiger Schritt. Nun heißt es hier in Nordkorea, ich darf das mal betonen, wie bei Don Carlos: Geben Sie Gedankenfreiheit, Sire! Das ist doch etwas. Wer hätte das gedacht? “ Der Kulturfunktionär hat die Hände gefaltet und lächelt zufrieden wie eine Buddha-Statue.
Wir suchen Don Carlos. Wir fahnden nach der Gedankenfreiheit im kommunistischen Orwell-Staat klassischer Prägung. Wir entdecken Maria Stuart und Wilhelm Tell. Schillers Don Carlos finden wir nicht. Schade. Das mit der Gedankenfreiheit kann Herr Schmelter sicherlich noch ändern. Im Goethe-Lesesaal ist jetzt mächtig Gedränge. Das offizielle Programm ist absolviert. Die Premiere hat stattgefunden. Das Publikum bestaunt die Inszenierung auf 140 Quadratmetern Deutschland. Die jungen Damen in ihren traditionellen koreanischen Gewändern lächeln stumm. Die Herren in Schwarz mit ihrem grienenden roten Kim Il Sung Button am Revers bleiben genauso stumm. Sie beobachten misstrauisch, wachsam und distanziert das Treiben.

Großer Andrang im Lesesaal nach der Eröffnung.
Die deutsche Delegation gibt sich siegessicher, stolz und selbstbewusst. Die Goethe-Delegation ist hier wer. Der nordkoreanische Kulturfunktionär, der genau so aussieht, wie man sich ihn vorstellt, spricht in seiner abgelesenen Rede mindestens ein Dutzend Mal von Deutslandu. Wenigstens einmal kommt auch Kim Il Sung vor. Das muss wohl sein. Ohne ihn geht es nicht.Der große geliebte Führer ist immer dabei.
Die mitgebrachten Bierflaschen klappern in der Plastiktüte. Wir hasten durch eine riesige leere Vorhalle. Kein Mensch ist zu sehen. Wir befinden uns im Fernseh-Gebäude, im Zentrum der Propaganda-Zentrale, sozusagen im Herzen des Schurkenstaates. Der Direktor des Hauses und eine gut aussehende Mitarbeiterin empfangen uns in einem viel zu großen Raum mit dekorativen Sesseln, Sofas und einer hochmodernen Schnitteinheit. Der Schneideraum scheint für uns extra präpariert worden zu sein. Wer sonst in der Welt verfügt schon über bequeme Sofas am Arbeitsplatz? Die Gastgeber sind freundlich, professionell, aber höflich reserviert.

Gelingt die Überspielung nach Mainz? Die erste TV-Direktleitung Nordkorea – Deutschland erlebt ihre Premiere.
Wir bereiten eine weitere Premiere vor. Wir stehen kurz vor der ersten Überspielung einer Fernsehnachricht von Nordkorea nach Frankfurt in der fernen Bundesrepublik Deutschland. Nach vielfältigen diplomatischen Aktivitäten, Gesprächen, Telefonaten und Kontakten läuft alles problemlos. Wir können unser selbstgedrehtes Material von unserer Kamera direkt einspeisen. Ein kleines Verbindungskabel, mehr ist nicht erforderlich.
Alles klappt. Goethe wird über einen Satelliten von Pjöngjang nach Frankfurt gejagt. 7.000 Kilometer in Echtzeit, eins zu eins ohne Komplikationen und Störungen. Die Nachricht kommt an. BBC, CNN und viele weitere Sender von Australien bis Island schließen sich an. Unsere Bilder laufen rund um die Welt. Es geht also, wenn man nur will. Das Land, das sich wie kein anderes abschottet , sendet neue, andere Lebenszeichen in die Welt. Nachrichten über Austausch, Kommunikation und Information.
Wir öffnen die mitgebrachten Bierflaschen, Marke Tiger. Das Bier kommt aus Singapur und stammt aus dem Intershop. Die Stimmung wird dank Tiger gelöster. Der Direktor schreibt einen Vertrag. Der Preis ist überraschend niedrig. 600 Euro. Das ist gerade einmal die Hälfte der verlangtem Summe vom Vorabend und nicht zu vergleichen mit den 15.000 $ , die zunächst als Forderung im Raum standen.

Ein Lächeln für die Hotelgäste aus Deutslandu…
Wer hat da hinter den Kulissen am Rad gedreht? Wir wissen es nicht. Wir lassen das Tiger-Bier kreisen. Ich zahle in Euro. Das ist die Leitwährung in Nordkorea. Die Funktionäre lieben unsere Währung mehr als den verhassten Dollar. Wir tauschen kleine Freundlichkeiten aus, stoßen ein letztes Mal auf die Völkerfreundschaft an und verlassen mit unseren drei Aufpassern das leere Gebäude. In der Empfangshalle verabschiedet uns Kim Il Sung, der von einem gigantischen Gemälde weise auf uns herab lächelt.
Es ist 22Uhr 30. Pjöngjang schläft bereits. Wir rumpeln in unserem japanischen Kleinbus durch die Straßen der Hauptstadt. Nur die Scheinwerferkegel werfen ein fahles Licht auf den Asphalt. Die Stadt ist stockdunkel und wirkt wie ausgestorben. Keine Menschenseele ist zu sehen. Kein Licht lenkt ab. Der Fahrer konzentriert sich auf den Weg.

Einzig und allein der Juche-Tower war noch hell erleuchtet. Wenig später wurde alle Straßenbeleuchtung abgeschaltet – Energieeinsparung, so die Begründung
Es ist dunkel in Nordkorea, selbst in der Hauptstadt. Das Regime muss sparen. Es herrscht totaler Energiemangel. Die Kraftwerke werden stundenlang abgeschaltet. Das Land hat keine Devisen für Rohstoffe. Das Militär verschlingt alles. Einzig und allein am Denkmal für den Großen Führer brennt Licht. Kim Il Sung strahlt einsam und allein in der Dunkelheit, wer sonst?
Um 23 Uhr verlischt auch bei ihm das Licht. Dann ist für wenige Minuten wieder diese geheimnisvolle Melodie zu vernehmen, die so melancholisch die Bürger dieses Landes in die Betten schickt.

Fortsetzung folgt.